ResiGov: Resiliente Hochschulgovernance im Angesicht von Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit. Handlungsoptionen aus einem internationalen Vergleich
Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit nehmen weltweit zu und erfolgen mit unterschiedlichen Zielsetzungen und durch unterschiedliche Akteure. Doch Hochschulen und ihrem Leitungspersonal fehlen empiriegestützte Handlungsoptionen, die Gegenmaßnahmen oder strategische Vorbereitungen auf solche Angriffe anleiten könnten. ResiGov erarbeitet solche Handlungsoptionen. Dazu werden eine international ausgerichtete Quellenanalyse sowie leitfadengestützte Interviews mit Betroffenen durchgeführt. ResiGov entwickelt eine bisher fehlende… mehr
ILLUME: Potenziale komplementärer Forschungspraxen im Hochschulsystem: Beiträge und Strukturen künstlerischer Forschung und deren Integration an Kunst- und Musikhochschulen
Das Verbundvorhaben ILLUME wird gemeinsam mit der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF durchgeführt. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen des im Februar 2024 erfolgten Förderaufrufs „Thematische, personelle und internationale Erweiterung der Wissenschafts- und Hochschulforschung“ im Förderschwerpunkt Wissenschafts- und Hochschulforschung (WiHo) ausgewählt (FKZ: 16RBM1002A). Im Zentrum des Projekts stehen –… mehr
Die vier Dimensionen des ostdeutschen Wissenschaftsumbaus in den 1990er Jahren
Der ostdeutsche Wissenschaftsumbau in den 90er Jahren ist inzwischen ein zeithistorisches Thema. Dennoch wird er in jüngerer Zeit intensiviert zu einem Gegenstand öffentlicher Debatten und der Forschung, was aus Gegenwartsinteressen gespeist ist: Der Wissenschaftsumbau gilt als einer der Vorgänge, der in seiner Konfliktintensität herangezogen werden müsse, wenn man die anhaltenden Verwerfungen innerhalb der ostdeutschen Teilgesellschaft… mehr
Evaluation des Deutschlandstipendiums
Vom Oktober 2024 bis Juli 2027 wird im Auftrag des BMBF eine umfassende Evaluation des Deutschlandstipendiums durchgeführt. Im Fokus steht die Entwicklung des Programms seit der letzten Evaluation 2016 sowie die Analyse von Zielerreichung, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Untersucht werden unter anderem die Sozialstruktur der Geförderten, der Studienerfolg, die regionale Vernetzung zwischen Hochschulen und Förderern sowie… mehr
Ein Forschungsmuseum: Wittenberger Lutherhalle und Stiftung Luthergedenkstätten 1883–2023
„Das wissenschaftliche Prinzip der Lutherhalle“ titelte Lutherhallen-Direktor Oskar Thulin, als er im Mai 1933 seine Antrittsvorlesung als Privatdozent an der Universität in Halle hielt. „Ohne Forschung geht es nicht“, schrieb die Stiftung Luthergedenkstätten 2022, als sie die ersten 25 Jahre ihres Bestehens resümierte. Das Wittenberger Reformationsgeschichtliche Museum, seit den 1870er Jahren vorbereitet und 1883 als… mehr
Private Hochschulen in Deutschland: Meta-Projekt
Das Förderprogramm „Forschung über nicht-staatliche Hochschulen“ des BMFTR soll ein bisher weitgehend unerforschtes Feld transparenter machen. Seine Einzelprojekte arbeiten an unterschiedlichen Institutionen, insofern zunächst isoliert voneinander, und inhaltlich fokussieren sie jeweils auf ein Spezialthema, zu dem sie spezifisches Detailwissen generieren. Das HoF hat die Aufgabe übernommen, ein Metaprojekt zum Förderprogramm durchzuführen. Dieses soll erstens die… mehr
Die Universität Halle-Wittenberg und die Stadt Wittenberg seit 1817: eine Beziehungsgeschichte
Hochschulfusionen sind auch dann immer noch heikle Angelegenheiten, wenn beide vorherigen Standorte beibehalten werden. Besonders heikel aber sind sie, wenn dabei einer der Standorte aufgegeben wird. So geschehen 1817, als die Universität Wittenberg (gegr. 1502) in die hallesche Universität (gegr. 1694) integriert wurde. Der symbolische Ausweg, um die Sache etwas abzufedern, war die neue Namensgebung:… mehr
FoPers: Nur am Rande? Die Forschung und ihr Personal an privaten Hochschulen
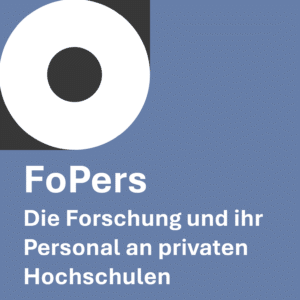
Die Lehre hat an privaten Hochschulen einen besonderen Stellenwert. Gemäß der Definition von Hochschulförmigkeit muss die Lehre forschungsbasiert sein. Die meisten Privathochschulen gelten als Einrichtungen mit geringer Forschungstiefe. Dafür gibt es vor allem strukturelle Gründe: (a) Rund 85 Prozent sind Fachhochschulen. (b) Forschung und ihre Infrastruktur kann an privaten Hochschulen nur auf geringe finanzielle Ressourcen… mehr
Vielfalt und Chancengerechtigkeit bei Fachgesellschaften
In Deutschland gibt es mehr Fachgesellschaften als Hochschulen. Wissenschaftliche Sozialisation und Verbundenheit der wissenschaftlichen Mitglieder an Hochschulen werden dabei oft stärker durch wissenschaftliche Gemeinschaften als durch die Organisation Hochschule geprägt. Fachgesellschaften können außerdem berufsethische sowie disziplinäre fachliche Standards im Speziellen und Wissenschaft im Allgemeinen gestalten und zwischen (Fach-)Wissenschaft und anderen Gesellschaftsbereichen vermitteln. Im Forschungsprojekt wird… mehr
Hochschulpolitik der Nachkriegszeit in Ost- und Westdeutschland
Nach 1945 wurde das deutsche Hochschulwesen von einer Reformdebatte um die soziale Öffnung der Universität und ihr Verhältnis zur staatlichen Aufsicht ergriffen, deren Fortgang in Ost- und Westdeutschland unter dem Einfluss der Besatzungsmächte und zonaler bzw. lokaler Funktionsträger radikal unterschiedliche Entwicklungen nach sich zog. Das ostdeutsche Hochschulwesen wurde dabei phasenweise zentralisiert und mit Parteistrukturen durchsetzt,… mehr
PersöSo: Persönlichkeitsentwicklung vs. Personalentwicklung?
Die Relevanz von Kompetenzen für Studium und Arbeitswelt in der Spannung zwischen Bildung und Ausbildung Hochschulstudien werden (statt anderer Qualifizierungswege) deshalb angeboten und absolviert, weil sich deren Absolvent.innen in ihren beruflichen Handlungskontexten typischerweise nicht in Routinesituationen, sondern in Situationen der Ungewissheit, konkurrierender Deutungen und Normenkonflikte, zugleich aber auch des Zeitdrucks und Handlungszwanges zu bewegen haben…. mehr
Einsatz generativer KI-Tools in der Hochschulkommunikation

Im Rahmen dieses Projekts untersuchen wir den Einsatz von generativen KI-Tools wie ChatGPT, Bing Chat u.a. in der Öffentlichkeitsarbeit von Hochschulen. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Nutzung und Wahrnehmung dieser Technologien in der Hochschulkommunikation zu gewinnen. Hierzu werden Kommunikationsabteilungen und Pressestellen deutscher Hochschulen mittels einer kurzen Online-Befragung kontaktiert und gebeten, Fragen zu… mehr
DDR-Wissenschaftsbelletristik: Erschließung einer bislang unbeachteten sozialhistorischen Quellensorte
Es gilt als Trivialwissen, dass die DDR-Belletristik die Funktion einer Ersatzöffentlichkeit wahrgenommen hatte – sie habe hier übernommen, was die Massenmedien nicht leisteten. Das gilt auch für die DDR-Literatur, die den Wissenschaftsbetrieb und/oder das Wissenschaftsmilieu erzählerisch aufbereitet. Zwar gab es in der DDR keine Campusliteratur, wie sie etwa aus dem angelsächsischen Raum bekannt ist. Doch… mehr
Die bundesweite Wissenschaftskommunikationslandschaft: Teilstudie Sachsen-Anhalt
Im Rahmen des Projekts „Wissenschaftskommunikation in Deutschland: Status Quo in den Ländern“ führt HoF im Auftrag der „Transfer Unit Wissenschaftskommunikation“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) die Teilstudie zur Situation in Sachsen-Anhalt durch. Neben einer Bestandsaufnahme gestaltender und fördernder Akteure werden Experteninterviews geführt. Erzeugt werden soll ein Überblick zu den wichtigen Akteuren und Aktivitäten im… mehr
Metadaten und Online-Metaportal zur akademischen Lehre
Das Vernetzungsprojekt „Portale: Interoperabilität, Metadaten, Standards“ schafft einen zentralen digitalen Anlaufpunkt für die zahlreichen und nicht immer leicht auffindbaren Portale mit Online-Ressourcen zur Hochschulbildung. Das Metaportal wird die Auffindbarkeit von Ressourcen zu Lehr-Lernmethoden und -formaten, Projekten, Veranstaltungen, Beispielen guter Pra- xis, organisatorischen Rahmenwerken, Qualitätsmanagement-Tools und Open Educational Resources verbessern. Das Institut für Hochschulforschung hat die… mehr
Stand und Perspektiven der Implementierung von Hochschuldidaktik in der Governance der öffentlichen Universitäten in Österreich (HoDi-Austria)
Hochschuldidaktik kann auf unterschiedliche Weise in Universitäten verankert sein. Im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) beschäftigt sich die Studie mit der Art und Weise der Implementierung an den 22 öffentlichen Universitäten Österreichs. Im Rahmen der Studie werden folgende Leitfragen bearbeitet: Wie ist Hochschuldidaktik in die Governance der österreichischen öffentlichen Universitäten… mehr
SuRele: Auf der Suche nach Relevanz. Transfererwartungen und -effekte zwischen Hochschulforschung und -entwicklung
Die Hochschulforschung wird nicht allein für Wissensproduktion, sondern genuin auch für den Wissenstransfer unterhalten. Zugleich gibt es Wahrnehmungen, dass sie der Transferaufgabe nur unzulänglich gerecht werde. In vier Schritten sollen ein informierteres Bild des hochschulforscherischen Transfergeschehens entwickelt und erfolgversprechende Transfermuster identifiziert werden: (1) Durch einen internationalen Vergleich wird ein empirischer Maßstab entwickelt, um die deutsche… mehr
WiKET: Wirksame Kriterien für Entbürokratisierung im Transfer

Forschungstransfer wird seit Jahrzehnten gefordert, gefördert – und verhindert. Transfer kann an Hochschulen nur stattfinden, wenn er in Regularien eingebettet ist und organisiert wird. Hier kommt die Spannung zwischen Bürokratie als rationaler Verwaltung und Bürokratie als Bürokratismus zum Tragen. Ist die Transferadministration überbordend komplex, so führt das zu Schwierigkeiten für die an Transfer beteiligten Akteur.innen… mehr
ForEinT: Forschungstransfer durch Einrichtungen mit eingeschriebenem Transferauftrag

Es gibt gesellschaftliche Wahrnehmungen, dass Wissenschaft der Kontaktpflege mit der Nichtwissenschaft ausweiche oder dafür über keine angemessenen Instrumente verfüge. Dies dürfte von ihrer Funktionsbestimmung her zumindest bei drei Institutionentypen nicht der Fall sein, da diesen ein Transferauftrag eingeschrieben ist: den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der Fraunhofer-Gesellschaft und den Ressortforschungseinrichtungen. Das Projekt rückt daher folgende Fragestellung… mehr
Wissenschaftliche Kommunikation in der DDR
Für die Wissenschaft ist freie Kommunikation essenziell. Für Diktaturen aber ist Kommunikationskontrolle essenziell. Damit gab es für die Wissenschaft in der DDR ein Problem. Das galt in unterschiedlichem Maße für die Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Erstere hatten keinen gesellschaftssystemspezifischen Referenzraum, letztere schon. Insbesondere nach dem Mauerbau wurde die freie Fachkommunikation eingeschränkt. Vor allem in der internationalen… mehr