Parallelwelt. Konfessionelles Bildungswesen in der DDR. Handbuch

Als Abschluss der von 2016 bis 2019 erarbeiteten Dokumentationen zum konfessionellen Bildungswesen in der DDR ist nun ein Handbuch erschienen, das alle Bildungsbereiche präsentiert: von der Elementarbildung bis zur Erwachsenenbildung incl. Mediensystem. Vorgestellt werden insgesamt 1.432 Einrichtungen und Bildungsformen, die in den Jahren 1945 bis 1989 in der SBZ/DDR bestanden hatten. Damit konnte nun eine… mehr
Input‐ und Leistungsdaten der Hochschulen in den ostdeutschen Flächenländern unter besonderer Berücksichtigung der Universitäten

Die ostdeutschen Universitäten haben 2018 im Wettbewerb um Exzellenzcluster in der Exzellenzstrategie vergleichsweise schlecht abgeschnitten. Um der Ursachenanalyse eine Grundlage zu geben, wird hier eine Aufbereitung relevanter Input‐ und Leistungsdaten vorgelegt. Um Verzerrungen auszuschließen, werden dabei allein die Flächenländer einbezogen, d.h. die Stadtstaaten aus der Betrachtung ausgeschlossen. Den Durchschnittswerten für die ostdeutschen Flächenländer werden jeweils… mehr
Kooperationsplattformen: Situation und Potenziale in der Wissenschaft Sachsen-Anhalts
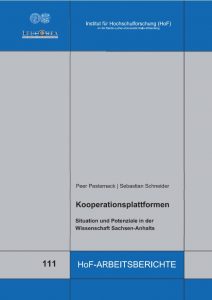
Kooperationen in der Wissenschaft sind eine Chance, durch Potenzialzusammenführungen Leistungen zu steigern, auch gemeinsam mit nichtwissenschaftlichen Partnern. Der Wissenschaftsrat hatte dazu 2013 der sachsen‐anhaltischen Wissenschaft die vermehrte Bildung von Kooperationsplattformen (KPF) nahe gelegt. Wie sieht es diesbezüglich fünf Jahre später aus? Es gibt 15 Initiativen, die alle Kriterien für eine KPF erfüllen, und 19 Initiativen… mehr
Administrationslasten. Die Zunahme organisatorischer Anforderungen an den Hochschulen: Ursachen und Auswege
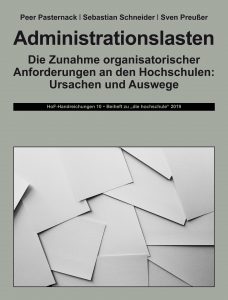
Die Wahrnehmungen des Hochschulpersonals sind durch zweierlei geprägt: Entstaatlichung habe neue Bürokratieanforderungen gebracht, und die Verwaltung der strukturierten Bologna-Studiengänge ginge gleichfalls mit neuen Belastungen einher. Die Handreichung widmet sich den Ursachen der Zunahme organisatorischer Anforderungen an den Hochschulen und zeigt Optionen für Problembearbeitungen auf. Die Hochschulen reagieren auf steigende Administrationslasten vor allem auf zwei Wegen:… mehr
Das andere Bauhaus-Erbe. Leben in den Plattenbausiedlungen heute

2019 wird das Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ gefeiert. Dabei gibt es eine bemerkenswerte Lücke. Das Jubiläum feiert die Prägungen des Designs und der Architektur, die heute noch als schick gelten. Die Radikalisierung des Neuen Bauens in Gestalt industriell errichteter Plattenbausiedlungen als das andere Erbe indes ist abwesend. Doch war der industrialisierte Wohnungsbau (auch) am Bauhaus… mehr
Kein Streitfall mehr? Halle-Neustadt fünf Jahre nach dem Jubiläum
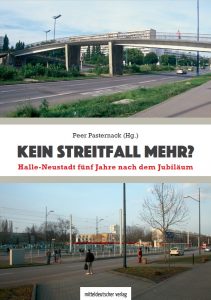
Das hier vorgelegte Buch hat zwei Anlässe. Der erste: Die Gründung Halle‐Neustadts hatte sich 2014 zum 50. Male gejährt. Zwar war das 50‐Jahres‐Jubiläum ein vornehmlich lokales Ereignis geblieben, obgleich das Entstehen der Plattenbaustadt für fast 100.000 Einwohner seinerzeit international beachtet und häufig mit der Niemeyerschen Umgestaltung Brasilias (1957– 1964, seit 1987 Weltkulturerbe) verglichen worden war…. mehr
Forschungslandkarte Demographischer Wandel
Immer wieder wird darauf verwiesen, dass es nicht in erster Linie an validem wissenschaftlichen Wissen zu den Problemen des demographischen Wandels mangele. HoF erarbeitet deshalb für die Expertenplattform „Demographischer Wandel in Sachsen-Anhalt“ eine neue Forschungslandkarte zur demographierelevanten Forschung erarbeitet (die letzte war 2014 vorgelegt worden). Sie fokussiert auf Sachsen-Anhalt (und die ostdeutschen Länder), geht aber… mehr
Kooperationsplattformen in der Wissenschaft Sachsen-Anhalts
Kooperationen in der Wissenschaft gelten als Chance, durch Potenzialzusammenführungen Leistungen zu steigern, auch gemeinsam mit nichtwissenschaftlichen Partnern. Der Wissenschaftsrat hatte 2013 der sachsen-anhaltischen Wissenschaft dazu die vermehrte Bildung von Kooperationsplattformen nahe gelegt. Wie sieht es diesbezüglich fünf Jahre später aus?
Broschüre Das andere Bauhaus-Erbe: Leben in den Plattenbausiedlungen heute
Hier geht es zur Broschüre 2018 waren die ländlichen Regionen das Thema des Workshops der Expertenplattform Demografischer Wandel in Sachsen-Anhalt (EPF), 2019 nun die Problemfälle im urbanen Bereich: die Plattenbausiedlungen. Dabei erwies es sich als Vorteil, dass das zeitgleich begangene Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ eine Lücke gelassen hatte. Es feierte die Prägungen des Designs und… mehr
Graduiertenkolleg „Wissenschaftsmanagement und Wissenschaftskommunikation“ – HoF-Teilprojekt „Konfliktgovernance in der Wissenschaft“ und „Digital entgrenzte Wissenschaftskommunikation“

Vom 1.7.2019 bis 30.6.2023 wird im Verbund von Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU), Institut für Hochschulforschung an der Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg (HoF) und Deutscher Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) ein Graduiertenkolleg, gefördert aus Mitteln des BMBF, durchgeführt. Das Kolleg beabsichtigt dreierlei Zusammenführungen: erstens Fragestellungen der Hochschul- und Wissenschaftsforschung, zweitens forschungsorientierten wissenschaftlichen Nachwuchs und Praktiker.innen des Wissenschaftsmanagements sowie drittens… mehr
Forschungslandkarte Demographischer Wandel
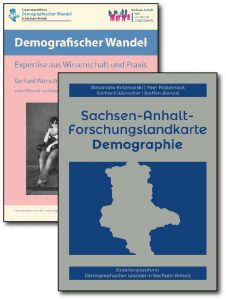
Immer wieder wird darauf verwiesen, dass es nicht in erster Linie an validem (wissenschaftlichen) Wissen zu den Problemen des demographischen Wandels mangele, sondern eher aussichtsreiche Umsetzungsstrategien auf verschiedenen Ebenen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fehlten. Zwei Publikationen zeigen auf, in welch reichem Maße solche Expertise verfügbar ist und dass bei Land und Kommunen durchaus eine… mehr
Fünf Jahrzehnte, vier Institute, zwei Systeme. Das Zentralinstitut für Hochschulbildung Berlin (ZHB) und seine Kontexte 1964–2014
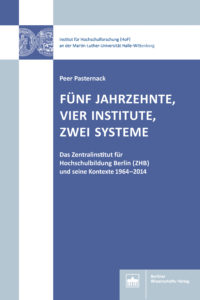
1964 war das Institut für Hochschulpolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin gegründet worden. 2014 war das Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) in seiner heutigen Form inhaltlich und organisatorisch konsolidiert. Dazwischen lagen noch zwei weitere Institute, sehr unterschiedliche Umfeldentwicklungen und mehrere krisenhafte Situationen, darunter ein Wechsel des Gesellschaftssystems. Diese Geschichte ist nun nachgezeichnet worden. Zu verfolgen… mehr
WissBei: Der Wissenschaftliche Beirat, das unaufgeklärte QE-Instrument
Die Anzahl wissenschaftlicher Beiräte nimmt zu. Sie dienen der wissenschaftlichen Beratung wissenschaftlicher Einheiten durch externe Wissenschaftler.innen. Mit ihnen verbinden sich Erwartungen der Rationalisierung von Entscheidungsprozessen und der Qualitätssteigerung bei den beratenen Einheiten. Während jedoch zu praktisch allen Instrumenten der Qualitätsentwicklung in der Wissenschaft Untersuchungen vorliegen, stellen die Wissenschaftlichen Beiräte eine unaufgeklärte Blackbox dar. Das vom… mehr
Wissenschancen der Nichtmetropolen. Wissenschaft und Stadtentwicklung in mittelgroßen Städten

Ein Großteil der einschlägigen Debatte zum Zusammenhang von Wissenschaft und ihren Sitzorten widmet sich großstädtischen bzw. metropolitanen Existenzbedingungen und Wirkungen. Hochschulen in mittelgroßen Städten schließen in ihren Selbstbeschreibungen häufig daran an, ohne den fehlenden großstädtischen Kontext angemessen zu berücksichtigen. Dahinter steckt die allgemeine Auffassung, dass sich die Zukunftsfähigkeit einer Stadt mit ihrer Ankopplung an wissensgesellschaftliche… mehr
Lebensbegleitend: Konfessionell gebundene religiöse, politische und kulturelle Allgemeinbildungsaktivitäten incl. Medienarbeit in der DDR

Allgemeinbildungsaktivitäten dienen vorrangig der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung und dem Gewinn eines souveräne(re)n Weltverhältnisses, zielen also nicht auf zertifizierte Abschlüsse und bestimmte Zugangsberechtigungen. Bildungsinstitutionen, in und von denen in der DDR konfessionell gebundene Allgemeinbildungsaktivitäten entfaltet wurden, waren die Evangelischen Akademien, Bildungshäuser und Rüstzeitheime, Arbeitsstellen für Erwachsenenbildung, die evangelischen Kunstdienste, Arbeitskreise, Bibelwochen und -fernkurse, die Kirchentagsarbeit und solche… mehr
Die verwaltete Hochschulwelt. Reformen, Organisation, Digitalisierung und das wissenschaftliche Personal

Für die Hochschulorganisation waren in den vergangenen 20 Jahren zwei politisch induzierte Reformen prägend: die New-Public-Management-inspirierten Governance-Reformen und der Bologna-Prozess. Sie waren mit zwei zentralen Versprechen verbunden: Die Governance-Reform versprach, Entstaatlichung werde mit Entbürokratsierung verbunden sein, und die Studienstruktur-Reform versprach, die Strukturierung erbringe eine Entlastung von den bisher nötigen fortwährenden Improvisationsanstrengungen. Dem stehen gegenteilige Wahrnehmungen… mehr
Arbeit an den Grenzen. Internes und externes Schnittstellenmanagement an Hochschulen
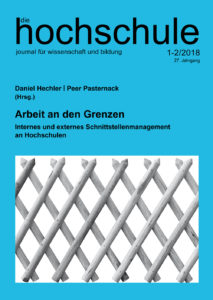
Innen und Außen des Hochschulsystems stellen eine sehr manifeste Grenze dar. Da beide jedoch über Finanzierung, Rechtsetzung, Legitimationsbedarfe und zertifikatsgebundene Berechtigungsstrukturen strukturell gekoppelt sind, ist diese Grenze zu bewirtschaften. Das geschieht, wie auch sonst, konflikthaft: in der Gegenüberstellung von Gesellschaft und Wissenschaft, in der Konkurrenz von Qualitäts- und Relevanzorientierung der Wissenschaft und den wahlweise ver-… mehr
Stadtentwicklung nach einem Jubiläum. Bildungsentwicklungen in Plattenbausiedlungen
Plattenbausiedlungen sind im Osten Deutschlands prägende Elemente der Stadtlandschaften, in den westlichen Bundesländern deren gelegentliche Ergänzungen. Funktional und sozial sind in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten die ostdeutschen Plattenbausiedlungen den westdeutschen sehr ähnlich geworden: Die verbliebenen Einwohner der Erstbezugsgenerationen einschließlich ihrer ersten Nachwuchskohorten haben eine hohe Identifikation mit ihrer jeweiligen Siedlung; Nachziehende sind vor allem dadurch… mehr
Wissenschaftskommunikation: Von der Organisations- zur Systemherausforderung
Neun Projekte wurden kürzlich oder werden aktuell am HoF bearbeitet, in denen Aspekte der Wissenschaftskommunikation eine Rolle spielen. Dieser Umstand wird genutzt, um das Thema als Metaprojekt zu bearbeiten. Die gesellschaftliche Situation ist durch eine abnehmende Komplexitätstoleranz in der Gesellschaft gekennzeichnet. Da Wissenschaft komplex ist und sein muss, ergeben sich daraus Legitimationsprobleme für die Wissenschaft…. mehr
EMOL: Entlastungsmanagement für die Organisation der Lehre
Lehre erfordert Organisation. Organisatorische Kontexte – häufig als Bürokratie wahrgenommen – prägen den Alltag Hochschullehrender und beeinflussen deren Lehrgestaltung. Dies geht (auch) zu Lasten der Lehrqualität, da individuelle und institutionelle Ressourcen gebunden werden. Werden die organisatorischen Kontexte der Lehre als qualitätsprägende Einflussgröße verstanden und sollen diese lehrqualitätsfördernd gestaltet werden, muss Qualität an Hochschulen als Qualitätsbedingungsmanagement… mehr