Koordinierung und Kommunikation: inhaltsbezogenes Förderprogramm-Management
Im Auftrag des BMBF werden Voraussetzungen und Erfahrungen mit Förderprogrammkoordinierungen im Bereich der Hochschul- und Wissenschaftsforschung ermittelt, systematisiert und in ein Handlungsprogramm überführt. Bei solchen Koordinierungen geht es vor allem darum, Übersetzungen des Forschungswissens, Aufmerksamkeitsmanagement und dazu Kommunikation verschiedener Art zu organisieren: zum einen wissenschaftliche Kommunikation, indem förderprogrammintern wechselseitige Anregungen der Projekte organisiert werden und… mehr
Gleichstellung an sächsischen Hochschulen
Im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst (SMWK) wird eine Studie zur Gleichstellung an den Hochschulen in Sachsen erarbeitet. Wesentliche Ausgangspunkte sind die Umsetzungsbilanz der Zielvereinbarungen 2014–2016, die gleichstellungspolitischen Initiativen und Weichenstellungen im Rahmen der Zielvereinbarungen 2017–2020 und der „Hochschulentwicklungsplanung 2025“. Im Zentrum steht, Entwicklung und aktuellen Stand des Gleichstellungsniveaus zu ermitteln, die… mehr
Systemische Rahmenbedingungen einer erfolgreichen Umsetzung digitaler Hochschulbildung
Für die Digitalisierung in der Hochschulbildung sind nicht allein technische Infrastrukturen aufzubauen. Vielmehr sind die – immer schon konfliktträchtigen – Schnittstellen zwischen Forschung, Lehre und Verwaltung sowie zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu rekonfigurieren. Hochschulen stehen hierbei zwar selbst in der Verantwortung, allerdings sind sie aufgrund enormer Investitionsbedarfe und der disruptiven Wirkungen der Digitalisierung in hohem… mehr
Gender Pay Gap bei Leistungsbezügen in der W-Besoldung
Es ist statistisch vielfach belegt, dass in Deutschland ungeachtet langjähriger gleichstellungspolitischer Bemühungen nach wie vor Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern (Gender Pay Gap) bestehen, die sich nicht allein durch Unterschiede bezüglich des Beschäftigungsumfangs oder des Qualifikationsniveaus erklären lassen. In wie weit der Gender Pay Gap auch im öffentlichen Dienst bei der höchstqualifizierten und hochselektiven Gruppe… mehr
Drei Phasen. Die Debatte zur Qualitätsentwicklung in der Lehrer_innenbildung

In der Studie wird die Qualitätsentwicklung der Ausbildung von Lehrenden an Schulen analysiert. Dabei werden alle drei Phasen der Ausbildung betrachtet: Studium, Vorbereitungsdienst, Fort- und Weiterbildung. So vermittelt die Expertise einen umfassenden Überblick über die Struktur der Lehrer:innenfortbildung im föderalen Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland.
Aktuelle Hochschul- und Wissenschaftskonzepte
Was unterscheidet eine Exzellenzuniversität von einer Elitehochschule? In der Regel wissen diese Frage nicht einmal die Vertreter von Hochschulen, die sich so nennen, präzise zu beantworten. Gibt es eine Differenz zwischen einer Hochschule als regionaler Wirtschaftsfaktor und als regionaler Innovationsfaktor? Ja, sie verläuft etwa zwischen ‚Wirtschaft‘ und ‚Innovation‘. Was ist eine geschlechtergerechte Hochschule und im… mehr
Ausleuchtung einer Blackbox. Die organisatorischen Kontexte der Lehrqualität an Hochschulen

Die Qualität der Lehre wird in drei Dimensionen entfaltet: (a) den curricularen Inhalten, (b) der didaktischen Vermittlung und (c) der Gestaltung der organisatorischen Kontexte. Die beiden erstgenannten befassen sich mit inhaltlichen Aspekten der Lehre. Letztere betrifft die ‚Bedingungen der Inhalte‘. Diese sind selbst keine Lehre, wirken für die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen aber entweder förderlich oder… mehr
Mission, die dritte. Die Vielfalt jenseits hochschulischer Forschung und Lehre: Konzept und Kommunikation der Third Mission

Hochschulen leisten heute durch Aufgaben wie Weiterbildung, Wissenstransfer oder Gründungsförderung weit mehr, als grundständige Studienangebote oder zweckfreie Grundlagenforschung zu betreiben. Allerdings sind Hochschulen zu diesem Teil ihres Leistungsspektrums nicht umfassend aussagefähig, da er zum großen Teil an individuelles Engagement gebunden und/oder auf Institutsebene verankert ist. Diese zusätzlichen Aufgaben, häufig Third Mission genannt, beschreiben gesellschaftsbezogene Aktivitäten… mehr
Hochschulsystemfinanzierung. Wegweiser durch die Mittelströme
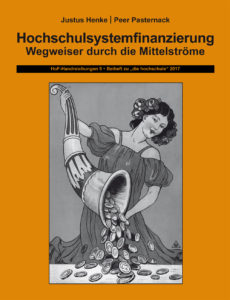
Die Finanzierung des Hochschulsystems ist mehr als die Finanzierung der Hochschulen, und die Finanzierung der Hochschulen selbst wiederum ist komplexer als gemeinhin angenommen. Die Finanzierungsquellen sind heterogen, und ihre Abbildung in Statistiken ist nicht immer transparenzfördernd. Neben den unmittelbaren institutionellen Förderungen gibt es programmgebundene und neben den konsumtiven die investiven Ausgaben. Neben den Bundesländern als… mehr
Wissenschaftspolitik in Sachsen-Anhalt 1990-2015
Wie gelang Wissenschaftspolitik in einem wiedergegründeten Land zunächst unter Transformationsbedingungen, dann unter Transformationsfolgewirkungen, d.h. unter Bedingungen weiträumigen wirtschaftlichen Niedergangs mit anschließender Re-Stabilisierung auf niedrigem (Produktivitäts-)Niveau, massiven demografischen Verwerfungen und haushalterischer Dauerkrise? Anhand fünf prägender Konkurrenzen und Konflikte werden die zentralen wissenschaftspolitischen Entwicklungen der zurückliegenden 25 Jahre in Sachsen-Anhalt resümiert. Sachsen-Anhalt steht hier exemplarisch für die… mehr
Inventur der Finanzierung des Hochschulsystems. Mittelvolumina und Mittelflüsse im deutschen Hochschulsystem
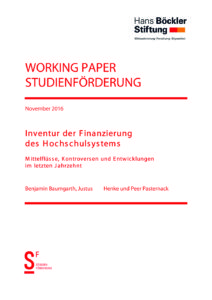
Die Bundesländer haben in den vergangenen zehn Jahren die lfd. Grundmittel zwar kräftig aufgestockt, eine Verbesserung der Ausgaben pro Student/in wurde aber nicht erreicht. Im Gegenteil: unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen sind die Pro-Kopf-Ausgaben in den meisten Bundesländern gesunken. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Steigerungen durch den Hochschulpakt und damit zum größen Teil dem Bund… mehr
Professorinnen, Professoren, Promovierte und Promovierende an Universitäten. Leistungsbezogene Vorausberechnung des Personalbedarfs und Abschätzung der Kosten für Tenure-Track-Professuren
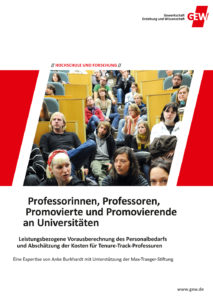
Welcher Bedarf an wissenschaftlichem Personal besteht an den Universitäten 2017 bis 2026, wenn zukünftige Leistungsanforderungen und bestimmte Qualitätsstandards berücksichtigt werden? Welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für das Finanzvolumen einer gezielten und bedarfsgerechten Förderung des Hochschullehrernachwuchses? Zur Beantwortung dieser Fragen legt die aktuelle HoF-Studie eine Prognose des künftigen Personalbedarfs und der daraus folgenden Kosten für Tenure-Track-Professuren… mehr
Perspektiven und Herausforderungen der österreichischen Fachhochschulen. Eine Vorausschau
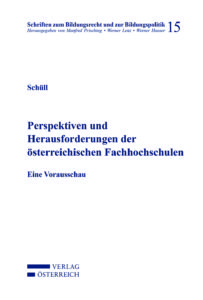
Die ersten FH-Studiengänge in Österreich nahmen 1994/95 ihren Betrieb auf. Aus den anfänglich knapp 700 Studierenden und zehn FH-Studiengängen sind zum Studienjahr 2015/16 rund 50.000 Studierende an 21 Fachhochschulen geworden. Ausgehend von den klassischen FH-Fächergruppen der Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften wurde das Fächerspektrum kontinuierlich erweitert. Die Umstellung auf das gestufte Studiensystem ist flächendeckend vollzogen, und auch… mehr
Fachhochschulen in Österreich – Eine Vorausschau
Im europäischen Vergleich hat Österreich erst spät einen Fachhochschulsektor etabliert. Die Nachzügler-Position wurde genutzt, um aus den Erfahrungen anderer Länder zu lernen und im Sinne des (damals neuen) New Public Managements effiziente ordnungspolitische Regelungen zu implementieren. Die bisherige Entwicklung wird gemeinhin als Erfolgsgeschichte beschrieben. Die Fachhochschulen haben sich zu einem festen Bestandteil der österreichischen Hochschullandschaft… mehr
OE-Prozess ASH Berlin
HoF begleitet einen internen Organisationsentwicklungsprozesses der Alice-Salomon-Hochschule Berlin (ASH). Die ASH ist eine der forschungs- und Third-Mission-stärksten HAWs in der Bundesrepublik, in den letzten zehn Jahren von 1.500 auf 3.500 Studierende expandiert und hat einen Schwerpunkt in Sozialer Arbeit sowie weitere Bereiche für Elementarbildung und Gesundheit.
Digitalisierung in der Wissenschaft als Organisationsproblem
In Wissenschaftseinrichtungen – Hochschulen und Forschungsinstitute – stoßen Digitalisierungsexperten fortwährend an Grenzen der Organisationsgestaltung, während Organisationsexperten unablässig Grenzen digitaler Prozessgestaltungen identifizieren. Dabei ist Digitalisierung z.B. an Hochschulen deutlich mehr als im vorherrschenden populären Verständnis, das sich auf OER oder MOOCs konzentriert: Digitalisierung in der Wissenschaft produziert einerseits Grenzüberschreitungen, die neue bzw. modifizierte regulative Zugriffe und… mehr
Hochschulpolitik in Deutschland: Strukturen, Prozesse, Akteure
Hochschulpolitik bezeichnet die staatlichen Maßnahmen, mit denen Lehre und Forschung an Hochschulen gefördert werden und beeinflusst werden sollen. Gestaltet wird dies im Rahmen eines komplexen Akteursgeflechts mit ebenso komplexen Prozeduren der Policy-Entwicklung. Es bestehen eine vertikale Differenzierung der Hochschulpolitik mit den Ebenen EU, Bund und Länder sowie horizontale Differenzierungen im adressierten Feld der Hochschulen. Dies… mehr
Bedarfsgerechte Personalausstattung von Universitäten
Vor dem Hintergrund der hochschulpolitischen Debatte um Beschäftigungsbedingungen und Karriereperspektiven in der Wissenschaft hat sich der Wissenschaftsrat für eine grundsätzliche Neugestaltung der Postdoc-Phase und der Wege zur Professur ausgesprochen. Bund und Länder haben eine gemeinsame Initiative für den wissenschaftlichen Nachwuchs ankündigt, über die ab 2017 mit einer Laufzeit von zehn Jahren 1,1 Mrd. bereitgestellt werden… mehr
Die BFI-Policy-Arena in der Schweiz

Die Akteurskonstellationen im Schweizer Bildungs-, Forschungs- und Innovationsystem (BFI) sind komplex. Rund 160 Akteure sind an der Vermittlung zwischen internen BFI-Leistungsprozessen und externen Leistungsansprüchen an den BFI-Bereich beteiligt. Die Herausarbeitung der Akteursanordnungen, der Interaktionen, Vermittlungsinstrumente und Policy-Prozesse sowie der Steuerungswiderstände und zentralen Konflikte liefert zugleich eine Einführung in die schweizerische BFI-Politik. Im Auftrag des Schweizerischen… mehr
Qualitätsentwicklung in der Lehrer_innenbildung
In der Evaluationsstudie wird die Qualitätsentwicklung der Ausbildung von Lehrenden an Schulen analysiert. Dabei werden alle drei Phasen der Ausbildung betrachtet: Studium, Vorbereitungsdienst, Fort- und Weiterbildung. So vermittelt die Expertise einen umfassenden Überblick über die Struktur der Lehrer:innenfortbildung im föderalen Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Qualitätssicherung und -entwicklung in der Lehrer_innenbildung hat zum einen die Besonderheiten… mehr