Generative KI in der Hochschulkommunikation. Ergebnisse der 2. Welle – 2024

Diese Studie untersucht erneut die Anwendung und Wahrnehmung generativer KI-Tools in der Hochschulkommunikation im Jahr 2024 und vergleicht die Ergebnisse mit 2023. Hochschulkommunikation umfasst die interne und externe organisationale Kommunikation der Hochschulen. Die Befragung unter deutschen Hochschulen fragte nach Nutzungsmustern, Herausforderungen und Potenzialen dieser Technologien. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung von Textgenerierungstools wie ChatGPT… mehr
Soziale Integration und nationale Identität. Eine Wiederbegegnung nach drei Jahrzehnten

Im April 1993 hielt Reinhard Kreckel seine Antrittsvorlesung an der Universität in Halle. Nachdem er zuvor an den Universitäten Aberdeen und Erlangen-Nürnberg gelehrt hatte, war er zum Gründungsprofessor an das hallesche Institut für Soziologie berufen worden. Als dessen Direktor sollte er dann mehrfach amtieren, ließ sich von 1994 bis 2000 als Prorektor und Rektor der… mehr
FoPers: Nur am Rande? Die Forschung und ihr Personal an privaten Hochschulen
Die Lehre hat an privaten Hochschulen einen besonderen Stellenwert. Gemäß der Definition von Hochschulförmigkeit muss die Lehre forschungsbasiert sein. Die meisten Privathochschulen gelten als Einrichtungen mit geringer Forschungstiefe. Dafür gibt es vor allem strukturelle Gründe: (a) Rund 85 Prozent sind Fachhochschulen. (b) Forschung und ihre Infrastruktur kann an privaten Hochschulen nur auf geringe finanzielle Ressourcen… mehr
Vielfalt und Chancengerechtigkeit bei Fachgesellschaften
In Deutschland gibt es mehr Fachgesellschaften als Hochschulen. Wissenschaftliche Sozialisation und Verbundenheit der wissenschaftlichen Mitglieder an Hochschulen werden dabei oft stärker durch wissenschaftliche Gemeinschaften als durch die Organisation Hochschule geprägt. Fachgesellschaften können außerdem berufsethische sowie disziplinäre fachliche Standards im Speziellen und Wissenschaft im Allgemeinen gestalten und zwischen (Fach-)Wissenschaft und anderen Gesellschaftsbereichen vermitteln. Im Forschungsprojekt wird… mehr
Vermittelnde Expertise. Schnittstellen von Management und Kommunikation im Wissenschaftssystem

Im neuen Heft der Zeitschrift „die hochschule“ liegt der Schwerpunkt auf den Rollen von Wissenschaftsmanagement und -kommunikation im Wissenschaftssystem. Das Heft ist zugleich eine Zwischenbilanz des Graduiertenkollegs „WiMaKo“. Einleitend wird dafür eine Perspektive als miteinander verwobene Schnittstellen entwickelt. Das BMBF-Graduiertenkolleg „Wissenschaftsmanagement und Wissenschaftskommunikation als forschungsbasierte Praxen der Wissenschaftssystementwicklung“ (WiMaKo) – betrieben von Uni Magdeburg, HoF… mehr
Der Wissenschaftliche Beirat. Das letzte bislang unaufgeklärte Qualitätsinstrument in der Wissenschaft

Unter den zahlreichen Instrumenten der wissenschaftlichen Qualitätssicherung und -entwicklung gibt es eines, zu dem bislang kaum systematisches Wissen vorlag: Wissenschaftliche Beiräte. In diesen werden Wissenschaftler.innen von anderen Wissenschaftler.innen in wissenschaftlichen Fragen wissenschaftlich beraten. Sie sind nun untersucht worden. Unter anderem ließ sich ermitteln, dass es im deutschen Wissenschaftssystem rund 2.500 solcher Beiräte gibt, in denen… mehr
Hochschulkommunikation im Zeitalter der KI: Erste Einblicke in die Nutzung und Perspektiven generativer KI-Tools
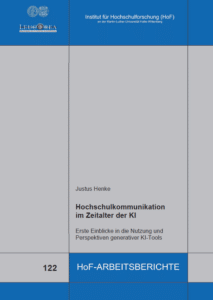
Erstmals wird hier eine empirische Erschließung über die Anwendung und Wahrnehmung von generativen KI-Tools in der Hochschulkommunikation vorgenommen. Hochschulkommunikation umfasst die interne wie externe organisationale Kommunikation der Hochschulen. Für diese Studie wurde eine Befragung unter deutschen Hochschulen durchgeführt, in der unter anderem nach Nutzungsmustern, Herausforderungen und Potenzialen dieser neuen Technologien gefragt wurde. Die empirischen Ergebnisse… mehr
Einsatz generativer KI-Tools in der Hochschulkommunikation

Im Rahmen dieses Projekts untersuchen wir den Einsatz von generativen KI-Tools wie ChatGPT, Bing Chat u.a. in der Öffentlichkeitsarbeit von Hochschulen. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Nutzung und Wahrnehmung dieser Technologien in der Hochschulkommunikation zu gewinnen. Hierzu werden Kommunikationsabteilungen und Pressestellen deutscher Hochschulen mittels einer kurzen Online-Befragung kontaktiert und gebeten, Fragen zu… mehr
Die bundesweite Wissenschaftskommunikationslandschaft: Teilstudie Sachsen-Anhalt
Im Rahmen des Projekts „Wissenschaftskommunikation in Deutschland: Status Quo in den Ländern“ führt HoF im Auftrag der „Transfer Unit Wissenschaftskommunikation“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) die Teilstudie zur Situation in Sachsen-Anhalt durch. Neben einer Bestandsaufnahme gestaltender und fördernder Akteure werden Experteninterviews geführt. Erzeugt werden soll ein Überblick zu den wichtigen Akteuren und Aktivitäten im… mehr
Wissenschaftskommunikation, neu sortiert
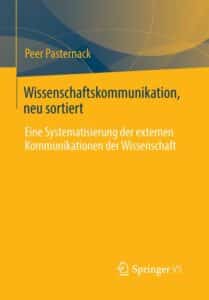
Der Ausgangspunkt für die Neusortierung des Feldes der Wissenschaftskommunikation ist: Wissenschaftskommunikation ist die Kontaktaufnahme und -pflege der Wissenschaft mit der Nichtwissenschaft, also mit ihrer Umwelt. Damit wird das Verständnis von Wissenschaftskommunikation sowohl eingeschränkt als auch erweitert: eingeschränkt auf die externe Kommunikation der Wissenschaft, erweitert auf jegliche Kontaktaufnahmen und -pflege der Wissenschaft mit der Nichtwissenschaft. Einerseits… mehr
ForEinT: Forschungstransfer durch Einrichtungen mit eingeschriebenem Transferauftrag

Es gibt gesellschaftliche Wahrnehmungen, dass Wissenschaft der Kontaktpflege mit der Nichtwissenschaft ausweiche oder dafür über keine angemessenen Instrumente verfüge. Dies dürfte von ihrer Funktionsbestimmung her zumindest bei drei Institutionentypen nicht der Fall sein, da diesen ein Transferauftrag eingeschrieben ist: den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der Fraunhofer-Gesellschaft und den Ressortforschungseinrichtungen. Das Projekt rückt daher folgende Fragestellung… mehr
Wissenschaftliche Kommunikation in der DDR
Für die Wissenschaft ist freie Kommunikation essenziell. Für Diktaturen aber ist Kommunikationskontrolle essenziell. Damit gab es für die Wissenschaft in der DDR ein Problem. Das galt in unterschiedlichem Maße für die Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Erstere hatten keinen gesellschaftssystemspezifischen Referenzraum, letztere schon. Insbesondere nach dem Mauerbau wurde die freie Fachkommunikation eingeschränkt. Vor allem in der internationalen… mehr
Wissenschaftsmanagement an außeruniversitären Forschungseinrichtungen
Die Rahmenbedingungen für die Forschung an außeruniversitären Forschungseinrichtungen (auFE) haben sich erheblich verändert. Managementorientierte Koordinations- und Gestaltungsprinzipien sind eine Reaktion auf gewandelte Anforderungen. Damit sollen die Rahmenbedingungen für die Forschung professionell gestaltet werden. Dies soll gelingen, indem auf Handlungsbedingungen bzw. Umsetzungskontexte der Forschung positiver Einfluss genommen wird. In diesem Zusammenhang versteht sich Wissenschaftsmanagement (WiMa) als… mehr
WiHoTop – Elemente einer Topografie der deutschen Wissenschafts- und Hochschulforschung
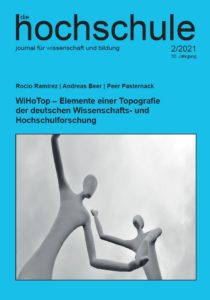
Das Institut für Hochschulforschung hat im Auftrag des BMBF eine Ermittlung zentraler Elemente einer Topografie der deutschen Wissenschafts- und Hochschulforschung (WiHoFo) unternommen. Im Mittelpunkt stehen Bestandsaufnahmen der Forschungskapazitäten des Feldes (Strukturressourcen: wissenschaftliche Einrichtungen, Gesellschaften und Vernetzungen; personelle Ressourcen und Beschäftigungsbedingungen), thematische Schwerpunkte, Bedeutsamkeitszuweisungen hinsichtlich wissenschaftlicher Aktivitäten (wissenschaftliche Kommunikation, Lehre und externe Wissenschaftskommunikation) sowie das Publikationsgeschehen.
Die externe Kommunikation der Wissenschaft in der bisherigen Corona-Krise (2020/2021). Eine kommentierte Rekonstruktion

Wissenschaftskommunikation in der Corona-Pandemie wird hier als Wissenschaftskrisenkommunikation verhandelt. Diese baute kommunikative Kanäle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auf oder aus, um pandemierelevantes Forschungswissen in die allgemeine Krisenkommunikation einzuspeisen. Ausgehend von einer Ereignischronologie der pandemiebezogenen Wissenschaftskommunikation werden deren Phasen bestimmt sowie die dominierenden Kommunikationsformen und Sprecherrollen herausgearbeitet. Dargestellt und diskutiert werden die Aufmerksamkeitskonkurrenz der wissenschaftlichen Disziplinen,… mehr
WiHoTop – Elemente einer Topografie der deutschen Wissenschafts- und Hochschulforschung
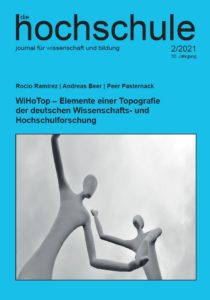
Das Institut für Hochschulforschung hat im Auftrag des BMBF eine Ermittlung zentraler Elemente einer Topografie der deutschen Wissenschafts- und Hochschulforschung (WiHoFo) unternommen. Im Mittelpunkt stehen Bestandsaufnahmen der Forschungskapazitäten des Feldes (Strukturressourcen: wissenschaftliche Einrichtungen, Gesellschaften und Vernetzungen; personelle Ressourcen und Beschäftigungsbedingungen), thematische Schwerpunkte, Bedeutsamkeitszuweisungen hinsichtlich wissenschaftlicher Aktivitäten (wissenschaftliche Kommunikation, Lehre und externe Wissenschaftskommunikation) sowie das Publikationsgeschehen…. mehr
Under the radar: The dynamics of multidirectional science communication in times of Corona
Das Projekt untersucht den Einfluss der Covid-19-Pandemie auf die Dynamiken der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Fördert oder behindert die Pandemie eine Transformation hin zu einem stärker partizipativen Ansatz, der gesellschaftliche Anspruchsgruppen möglichst gleichberechtigt einbezieht? Stärkere Partizipation wird seit einiger Zeit nicht nur von wissenschaftspolitischer Seite angemahnt, unter anderem um das Vertrauen der Bevölkerung in wissenschaftliches Handeln… mehr
HoF-Begleitstudie „Personalstrukturentwicklung und Personalentwicklung“ zum BuWiN 2021

Die Gestaltung attraktiver Beschäftigungsbedingungen und verlässlicher Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs steht seit mehr als einem Jahrzehnt auf der wissenschaftspolitischen Agenda. Statistische Analysen und Befunde der empirischen Forschung machen deutlich: An Hochschulen wie an außeruniversitären Forschungseinrichtungen besteht nach wie vor erheblicher Handlungsbedarf. Das betrifft insbesondere die anhaltend hohe Befristungsquote. Zu den positiven Entwicklungen zählen die… mehr
Das fünfte Jahrfünft. Forschung, Wissenstransfer und Nachwuchsförderung am Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) 2016–2020
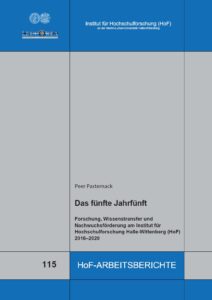
Das Institut für Hochschulforschung (HoF) bearbeitete 2016–2020 63 Projekte, davon 42 Drittmittelprojekte, finanziert von 17 Mittelgebern. Am intensivsten wurde in den Themenclustern „Bildungs-, Hochschul-, Wissenschaftsentwicklung in regionalen Kontexten, Third Mission“ sowie „Governance und Organisation von Wissenschaft“ gearbeitet. Das entspricht den auch vor 2016 bereits gepflegten Schwerpunkten. Ebenfalls intensiv wurden Themen in den Clustern „Zeitgeschichte von… mehr
Kultur und Gesellschaft gemeinsam erforschen. Citizen Science in den Geistes- und Sozialwissenschaften
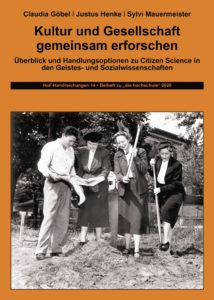
Die Situation und (mögliche) Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften in Citizen Science ist bislang vor allem wissenschaftspolitisch erörtert, selten jedoch empirisch ausgeleuchtet worden. Dadurch bleiben relevante Fragen offen, etwa wie die Vorhaben in der Praxis besser gelingen können und welcher Rahmensetzungen – z.B. durch die Politik – es dafür bedarf. Mit einer Handreichung stellt HoF… mehr