Paralleluniversen des Wissenschaftsmanagements: Ein Vergleich zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Forschungsqualität sowie das Ermöglichen dieser kann dreidimensional begriffen werden: (a) Fragestellungen und Methoden der Erkenntnisproduktionen, (b) apparative, infrastrukturelle und sonstige ressourcenspezifische Ausstattungen und (c) die Gestaltung der organisatorischen Kontexte. Letztere wirken für die Gestaltung von Forschungsprozessen entweder förderlich oder hinderlich. Damit nehmen sie ebenfalls Einfluss auf die Forschungsqualität. Um die organisatorischen Kontexte so zu gestalten,… mehr
WiKET: Wirksame Kriterien für Entbürokratisierung im Transfer

Forschungstransfer wird seit Jahrzehnten gefordert, gefördert – und verhindert. Transfer kann an Hochschulen nur stattfinden, wenn er in Regularien eingebettet ist und organisiert wird. Hier kommt die Spannung zwischen Bürokratie als rationaler Verwaltung und Bürokratie als Bürokratismus zum Tragen. Ist die Transferadministration überbordend komplex, so führt das zu Schwierigkeiten für die an Transfer beteiligten Akteur.innen… mehr
Forschungsbezogenes Wissenschaftsmanagement: Konzept und Vermessung. Lessons-Learned-Paper Nr. 1

Das Thema Wissenschaftsmanagement (WiMa) begleitet die Diskussionen um Qualitätssicherung und -entwicklung in Lehre und Forschung an Hochschulen bereits seit zwei Jahrzehnten. Die Diskussion über qualitätssichernde Effekte und Wirkungsbedingungen des Wissenschaftsmanagements im außeruniversitären Forschungssektor wird hingegen so gut wie gar nicht geführt oder bestenfalls beiläufig mitverhandelt. Die gemeinsame Betrachtung wie auch analysierende Unterscheidung des Wissenschaftsmanagements von… mehr
Under the radar: The dynamics of multidirectional science communication in times of Corona
Das Projekt untersucht den Einfluss der Covid-19-Pandemie auf die Dynamiken der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Fördert oder behindert die Pandemie eine Transformation hin zu einem stärker partizipativen Ansatz, der gesellschaftliche Anspruchsgruppen möglichst gleichberechtigt einbezieht? Stärkere Partizipation wird seit einiger Zeit nicht nur von wissenschaftspolitischer Seite angemahnt, unter anderem um das Vertrauen der Bevölkerung in wissenschaftliches Handeln… mehr
Kultur und Gesellschaft gemeinsam erforschen. Citizen Science in den Geistes- und Sozialwissenschaften
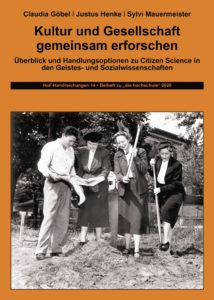
Die Situation und (mögliche) Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften in Citizen Science ist bislang vor allem wissenschaftspolitisch erörtert, selten jedoch empirisch ausgeleuchtet worden. Dadurch bleiben relevante Fragen offen, etwa wie die Vorhaben in der Praxis besser gelingen können und welcher Rahmensetzungen – z.B. durch die Politik – es dafür bedarf. Mit einer Handreichung stellt HoF… mehr
Wie die Hochschulen durch das Zeitalter des Frühdigitalismus kommen. Basiswissen für die avancierte Organisationsgestaltung in 94 Fragen und Antworten
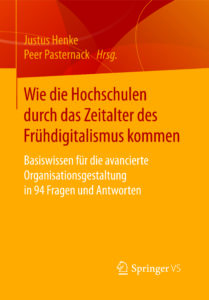
Dieses Buch bietet Basiswissen für die Organisationsgestaltung in 94 Fragen mit den dazu passenden kompakten Antworten von Expertinnen und Experten zum betreffenden Thema. Die leitende Perspektive ist: Digitalisierung muss ebenso als technischer wie als sozialer Prozess realisiert werden. An Hochschule treffen eindeutige Algorithmen auf vieldeutige Abläufe. Die Autoren und Autorinnen halten nicht alles deshalb für… mehr
Social Citizen Science in Germany – Basic Characteristics & Twenty Theses for Better Practice and Support
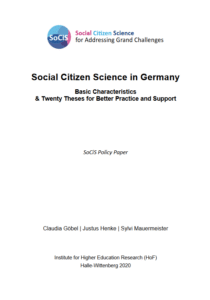
Citizen Science in the humanities and social sciences – Social Citizen Science (SCS) – is a sub‐area of Citizen Science activities that did not yet receive much scholarly attention. One feature of SCS is that it deals with data that can be difficult to objectify because of its proximity to everyday life. Questions of ensuring… mehr
Citizen Science jenseits von MINT – Bürgerforschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften

Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen verweisen auf neue Anforderungen zur Gestaltung des Verhältnisses zwischen Bürger.innen und Wissenschaftler.innen. Citizen Science erlangt seit einiger Zeit sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in wissenschaftlichen Kreisen zunehmende Aufmerksamkeit. Befunde zur Situation und möglichen Rolle von Citizen Science finden sich derzeit vor allem für den Bereich der Naturwissenschaften, Citizen Science im Bereich… mehr
Integrieren und kommunizieren. Leitfaden und Toolboxen zur koordinativen Begleitung von Forschungsverbünden und Förderprogrammen

Wie lassen sich Koordinierungen von Forschungsverbünden so gestalten, dass sie das Erreichen der Verbundziele – Erkenntniszuwachs und ggf. Transfer in Anwendungskontexte – mit vertretbarem Aufwand unterstützen können? Antworten dazu liefert ein Leitfaden mit Toolboxen. Letztere stellen insgesamt 55 Instrumente vor.
FortBeam: Forschungsqualität durch Wissenschaftsbedingungsmanagement

Qualitätssicherung der Forschung ist vielfach im Rahmen von QS- bzw. QM-Systemen prozesshaft systematisiert worden. Um die diesbezüglichen Prozesse zu optimieren, wurden zugleich assistierende Strukturen geschaffen: das Wissenschaftsmanagement. Um dessen reale Wirksamkeit zu ermitteln, wird eine Umkehrung der Perspektive benötigt. Statt zu fragen, welche QS durch welche Strukturen (und Personen, also Stellen) gefördert werden könnte, ist… mehr
Wissenschaftskommunikation als Anwort auf die Legitimationskrise? Die Rolle der Mesoebene
Staatlich finanzierte wissenschaftliche Einrichtungen stehen unter charakteristischem doppelten Legitimationsdruck: Einerseits müssen sie im institutionellen Wettbewerb Organisationsinteressen bedienen und Aufmerksamkeit für eigene wissenschaftliche Leistungen generieren; andererseits erwarten gesellschaftliche Teilöffentlichkeiten die glaubwürdige Vermittlung relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse unter Wahrung wissenschaftlicher Integrität. Diese strukturelle Spannung zwischen organisations- und gesellschaftsbezogenen Zielen wird durch die zunehmende Medialisierung der Wissenschaft verstärkt, die… mehr
Kommunikation organisieren. Die koordinierende Begleitung von Forschungsförderprogrammen, verhandelt an Beispielen aus der Bildungs‐, Wissenschafts‐ und Hochschulforschung

Die Auswahl von Projekten in Forschungsförderprogrammen erfolgt in Deutschland typischerweise wissenschaftsgeleitet. Die Kriterien beziehen sich also auf die Leistungsfähigkeit in der Forschung und die daraus folgenden Leistungserwartungen. Zwei Aspekte, die aus Sicht der Forschungsmittelgeber zunehmend bedeutsam sind, bleiben bei der Auswahl jenseits der Betrachtung. Das ist einerseits die Kooperation der gemeinsam ausgewählten Projekte, die je… mehr
Graduiertenkolleg „Wissenschaftsmanagement und Wissenschaftskommunikation“ – HoF-Teilprojekt „Konfliktgovernance in der Wissenschaft“ und „Digital entgrenzte Wissenschaftskommunikation“

Vom 1.7.2019 bis 30.6.2023 wird im Verbund von Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU), Institut für Hochschulforschung an der Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg (HoF) und Deutscher Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) ein Graduiertenkolleg, gefördert aus Mitteln des BMBF, durchgeführt. Das Kolleg beabsichtigt dreierlei Zusammenführungen: erstens Fragestellungen der Hochschul- und Wissenschaftsforschung, zweitens forschungsorientierten wissenschaftlichen Nachwuchs und Praktiker.innen des Wissenschaftsmanagements sowie drittens… mehr
Third Mission als Organisationsherausforderung. Neuausrichtung der Machtstrukturen in der Hochschule durch Professionalisierungstendenzen im Wissenschaftsmanagement
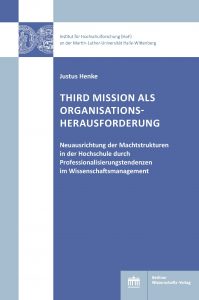
Von Hochschulen werden verstärkt zusätzliche Beiträge zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung erwartet, die sich unter dem Begriff Third Mission fassen lassen. Für eine strategische Entwicklung sind die Hochschulen allerdings auch auf das Wissenschaftsmanagement angewiesen, dessen konzeptionelle Zuarbeiten und operativen Tätigkeiten sie für die Organisation und Kommunikation der Third Mission benötigen. Anhand der Analyse der Beziehungen… mehr
Disruption oder Evolution? Systemische Rahmenbedingungen der Digitalisierung in der Hochschulbildung
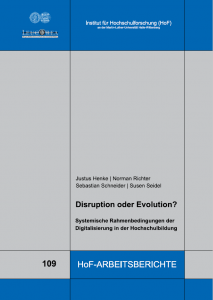
Hochschulbildung wird sicher nicht durchdigitalisiert, aber in jedem Falle digital unterstützt. Dafür sind nicht nur technische Infrastrukturen aufzubauen. Vor allem sind einige Schnittstellen neu zu gestalten: zwischen Forschung, Lehre und Verwaltung sowie zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Diese Schnittstellen waren immer schon konfliktträchtig, und digitale Neuerungen können hier nun entschärfen oder verschärfen. Das wird sich an… mehr
SoCiS: Social Citizen Science zur Beantwortung von Zukunftsfragen

Das Projekt widmet sich der Problemstellung, dass Citizen Science im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften – Social Citizen Science (SCS) – gerade aufgrund ihrer Nähe zur Alltagswelt schwer objektivierbare Beobachtungen verarbeitet und somit wenig immun gegen wissenschaftlich reformulierte Interessenpolitik einzelner Gruppen ist. Aber auch ohne bewusste Lenkung ist die Sicherstellung wissenschaftlicher Qualitätsansprüche bei der Beteiligung… mehr
- Projektflyer
- Thesenpapier zu Social Citizen Science
- SoCiS Policy Paper
- OER-Handbuch Social Citizen Science
Third Mission als Organisationsherausforderung
In dem Dissertationsprojekt werden Auswirkungen des Verhaltens der Wissenschaftsmanager.innen im Kontext von Aktivitäten untersucht, die in den Bereich der sog. Third Mission fallen. Hierbei interessiert zum einen, ob das Thema Third Mission insbesondere durch das Wissenschaftsmanagement für die Hochschule an Bedeutung erlangt. Zum anderen wird geprüft, ob Wissenschaftsmanager.innen Third Mission als Gelegenheit zur eigenen Professionalisierung… mehr
Die Ideen der Universität. Hochschulkonzepte und hochschulrelevante Wissenschaftskonzepte

Einst genügte es, von „universitas magistrorum et scholarium“, „universitas litterarum“, der „Humboldtschen Universitätsidee“ oder dem „Wesen der deutschen Universität“ zu sprechen, um ein allgemeines konzeptionelles Einvernehmen zu erzeugen bzw. zu bekräftigen. Seit der „Hochschule in der Demokratie“ ändert sich das: Die Hochschulexpansion verband sich mit einer Hochschulkonzepte-Expansion. Heute lassen sich 44 Konzepte identifizieren, die aktuelle… mehr
Koordinierung und Kommunikation: inhaltsbezogenes Förderprogramm-Management
Im Auftrag des BMBF werden Voraussetzungen und Erfahrungen mit Förderprogrammkoordinierungen im Bereich der Hochschul- und Wissenschaftsforschung ermittelt, systematisiert und in ein Handlungsprogramm überführt. Bei solchen Koordinierungen geht es vor allem darum, Übersetzungen des Forschungswissens, Aufmerksamkeitsmanagement und dazu Kommunikation verschiedener Art zu organisieren: zum einen wissenschaftliche Kommunikation, indem förderprogrammintern wechselseitige Anregungen der Projekte organisiert werden und… mehr
Systemische Rahmenbedingungen einer erfolgreichen Umsetzung digitaler Hochschulbildung
Für die Digitalisierung in der Hochschulbildung sind nicht allein technische Infrastrukturen aufzubauen. Vielmehr sind die – immer schon konfliktträchtigen – Schnittstellen zwischen Forschung, Lehre und Verwaltung sowie zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu rekonfigurieren. Hochschulen stehen hierbei zwar selbst in der Verantwortung, allerdings sind sie aufgrund enormer Investitionsbedarfe und der disruptiven Wirkungen der Digitalisierung in hohem… mehr