Konstrukteur 2020 (2010-2012)
Das Projekt beschäftigt sich mit dem Wandel der Tätigkeitsfelder und Ausbildungskonzepte von Konstrukteuren und Konstrukteurinnen in Entwicklung und Produktion. Eine Projektbeschreibung ist auf den Seiten des Auftraggebers, der deutschen Akademie für Technikwissenschaften (acatech), verfügbar. Projektpartner: Institut für Produktentwicklung (IPEK) am KIT – Karlsruher Institut für Technologie Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW) an der Leibniz… mehr
Wandel der Hochschulbildung in Deutschland und Professionalisierung
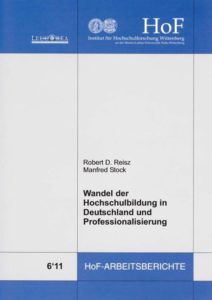
Das Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat das Verhältnis von Bildung und Gesellschaft anhand des relativen Gewichts der Studienfächer in der Zeitspanne von 1950 bis 2002 untersucht. Die Studie zeigt, dass im Zuge der Hochschulexpansion das Gewicht von Fächern mit beruflichem Anwendungsbezug zunimmt. Diese Verschiebung wird als Ausdruck einer Professionalisierung interpretiert. Mehr und… mehr
Skalenhandbuch für Untersuchungen der Lehrpraxis und der Lehrbedingungen an deutschen Hochschulen

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der Lehre im Hochschulbereich hat das Institut für Hochschulforschung die Lehrpraxis und die Lehrbedingungen mit einer Online-Befragung der Lehrenden untersucht. Das vorliegende Skalenhandbuch informiert über den Aufbau und die Anwendung des Erhebungsinstruments. Die Bologna-Reform hat einen doppelten, quantitativen wie qualitativen Effekt auf die akademische Lehre: Es gibt einen zunehmenden… mehr
Frühpädagogisch kompetent. Kompetenzorientierung in Qualifikationsrahmen und Ausbildungsprogrammen der Frühpädagogik

Die dynamischen Entwicklungen im frühpädagogischen Ausbildungssektor – Reformen in der Fachschulausbildung und Akademisierung unter Beteiligung sämtlicher Einrichtungen des tertiären Bereichs – wecken das Bedürfnis nach stärkerer Vergleichbarkeit. Dem widmet sich eine neue Studie aus dem Institut für Hochschulforschung (HoF). Ausgewertet werden darin 14 Ausbildungsdokumente wie Qualifikationsrahmen und Curricula. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen: Welchen Grad… mehr
Hochschulen nach der Föderalismusreform

Zwischen den Hochschulsystemen der deutschen Bundesländer bestehen traditionell deutliche Unterschiede hinsichtlich des Finanzierungsinputs und des Forschungsoutputs. Die Föderalismusreform 2006 hatte den Anspruch erhoben, wettbewerbsföderalistische Aspekte im Hochschulwesen zu stärken – und damit sowohl den herkömmlichen kooperativen Föderalismus als auch die aktive Beteiligung des Bundes an der Hochschulentwicklung in den Hintergrund treten zu lassen. Im vorliegenden… mehr
Qualifikationsprofile in Arbeitsfeldern der Pädagogik der Kindheit. Ausbildungswege im Überblick

Dargestellt wird, welche Charakteristika die frühpädagogischen Ausbildungsangebote auf den unterschiedlichen Ebenen aufweisen, aber auch welche Gemeinsamkeiten zu finden sind. Hierfür wurden die in den letzten Jahren entstandenen frühpädagogischen Fachqualifikationsrahmen hinsichtlich inhaltlicher und struktureller Überschneidungen wie Abgrenzungen ausgewerte, das Ausbildungs- sowie das Berufsfeld systematisiert und die Institutionentypen Fachschule für Sozialpädagogik und Hochschule vergleichend dargestellt. Ein „Erweitertes… mehr
Hochschulen, demografischer Wandel und Regionalentwicklung. Der Fall Sachsen-Anhalt

Der demografische Wandel fällt regional unterschiedlich aus. Um ihm angemessen zu begegnen, sind vornehmlich endogene Entwicklungspotenziale zu erschließen. Zu diesen zählen in besonderem Maße die Hochschulen. Eines der am stärksten von demografischen Veränderungen betroffenen Bundesländer ist Sachsen-Anhalt. Die daraus folgenden Herausforderungen für die Hochschulen sind Thema der soeben erschienenen Studie. Sachsen-Anhalt ist ein Bundesland, das… mehr
die hochschule 1/2011: Hochschulföderalismus
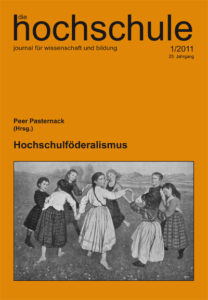
Das neue Heft der Zeitschrift „die hochschule“ bilanziert die Folgen der Föderalismusreform für den Hochschulbereich. Geschärft wird diese Bestandsaufnahme durch eine international vergleichende Perspektive, die exemplarisch die deutschen Entwicklungen mit den Föderalismusmodellen in Kanada und der Schweiz kontrastiert. Vor der Föderalismusreform 2006 wurde überwiegend das Bild eines zwar föderal verfassten, aber weitgehend homogenen Hochschulwesens in… mehr
Wandel der akademischen Bildung (1950-2005)
Im Projekt soll der Wandel akademischer Bildung mit Blick auf Deutschland (Bundesrepublik und DDR) in einer Längsschnittanalyse (1950-2005) empirisch analysiert werden. Erstens werden Verschiebungen innerhalb der Gesamtheit der Studienfächer untersucht, die im Untersuchungszeitraum an den Hochschulen angeboten wurden. Es geht dabei um das Erscheinen und das Verschwinden von Fächern sowie um die Entwicklung der Proportionen… mehr
Wer lehrt was unter welchen Bedingungen? Untersuchung der Struktur akademischer Lehre an deutschen Hochschulen
Ziel des Projektes ist es, die strukturellen Voraussetzungen für ein systematisches Qualitätsmanagement der Hochschullehre sichtbar zu machen. Zu diesem Zweck wird an ausgewählten Hochschulen eine Kompletterhebung des Lehrangebots durchgeführt: Die Lehrenden werden über die konkreten Lehrveranstaltungen, die sie in einem Semester durchgeführt haben, erfasst. Auf diese Weise wird der reale Lehrkörper anhand seiner tatsächlichen Lehrtätigkeit… mehr
Studierendenmobilität – ost- und westdeutsche Bundesländer

Mobilität ist einerseits seit Jahrhunderten Bestandteil studentischen Lebens, andererseits hat sie sich in ihrer Struktur mit der Bildungsexpansion deutlich verändert. Die Mobilitätsmuster haben sich seit der deutschen Vereinigung erneut deutlich gewandelt und erfahren im laufenden Jahrzehnt wiederum Veränderungen. Der Hochschulpakt 2020 stellt ebenso eine Reaktion darauf dar, wie er auch Anreize setzt, Mobilität aktiv zu… mehr
Relativ prosperierend. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Die mitteldeutsche Region und ihre Hochschulen

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stellen in sozioökonomischer Hinsicht die leistungsstärkste Großregion Ostdeutschlands dar. Gemeinsam bezeichnen sich die drei Länder als „Region Mitteldeutschland“ und untermauern dies durch diverse länderübergreifende Kooperationen. Zusammen haben sie neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Innerhalb Ostdeutschlands lässt die mitteldeutsche Region am ehesten erwarten, bis zum Auslaufen des Solidarpakts II im Jahre 2019… mehr
Das Menschenbild der PISA-Studie für Erwachsene: Grundlagen und Annahmen der internationalen OECD-Vergleichsstudie zur Messung des Kompetenzniveaus Erwachsener (PIAAC)
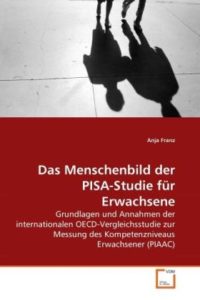
Seit der ersten Veröffentlichung der Ergebnisse des Programme for International Student Assessment (PISA) im Jahr 2001 hat es in Deutschland heftige Debatten über bildungspolitische Konsequenzen und den künftigen Kurs der Bildungspolitik nach dem „PISA-Schock“ gegeben. Bildungspoltische Themen erfreuen sich seither großer Aufmerksamkeit und das allgemeine Bedürfnis nach Vergleichen scheint stetig zu steigen. Nun sollen voraussichtlich… mehr
Hochschulprivatisierung und akademische Freiheit. Jenseits von Markt und Staat: Hochschulen in der Weltgesellschaft

Neoliberale Reformer wollen den Staat im Hochschulwesen zurückdrängen. Lehrende und Lernende sollen zu Marktteilnehmern werden, die Fachschulung als Dienstleistung handeln. Allerdings: Wenn die bürgerrechtliche Ordnung an Wirksamkeit gewinnt, kann statt marktwirtschaftlicher Zwänge auch die akademische Freiheit expandieren. Welche der beiden Alternativen sich in den Hochschulen tatsächlich durchsetzt, ist Thema dieser vergleichenden Studie des Hochschulwesens in… mehr
Die frühpädagogische Ausbildungslandschaft. Strukturen, Qualifikationsrahmen und Curricula

Im frühpädagogischen Ausbildungssektor vollziehen sich dynamische Entwicklungen: Reformen in der Fachschulausbildung und Akademisierung unter Beteiligung sämtlicher Hochschultypen von Berufsakademie über FH und PH bis zur Universität. Diese Parallelentwicklungen wecken das Bedürfnis nach stärkerer Vergleichbarkeit. In struktureller Hinsicht stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Welche frühpädagogischen Ausbildungen werden aktuell angeboten? Welche internen Strukturen weist die frühpädagogische Ausbildungslandschaft… mehr
Frühpädagogische Ausbildung
In der elementarpädagogischen Fachdiskussion gilt es als dringend erforderlich, das in der Vorschulphase wirkende pädagogische Personal höher als bisher zu qualifizieren, d.h. nicht nur auf Fachschul-, sondern auch auf Hochschulebene auszubilden. Dem steht die Auffassung gegenüber, dass diese Höherqualifikation deutliche Kostensteigerungen zur Folge hätte. 2006 hat HoF eine bildungsökonomische Berechnung der Kosten, die sich aus… mehr
Hochschulen nach der Föderalismusreform
Zwischen den Hochschulsystemen der deutschen Bundesländer bestehen traditionell deutliche Unterschiede hinsichtlich des Finanzierungsinputs und des Forschungsoutputs. Die Föderalismusreform 2006 hatte den Anspruch erhoben, wettbewerbsföderalistische Aspekte im Hochschulwesen zu stärken – und damit sowohl den herkömmlichen kooperativen Föderalismus als auch die aktive Beteiligung des Bundes an der Hochschulentwicklung in den Hintergrund treten zu lassen. Im Projekt… mehr
Wer lehrt was warum? Die Organisation der akademischen Lehre an deutschen Universitäten: Bedingungen, Strategien, Effekte
Unter der Leitfrage „Wer lehrt was warum?“ werden die Bedingungen, Strategien und Effekte der Organisation der akademischen Lehre an deutschen Hochschulen analysiert. Nachdem sich das Vorgängerprojekt unter der Fragestellung „Wer lehrt was unter welchen Bedingungen?“ auf die tatsächlich erbrachte Lehre an Hochschulen und die Lehrverteilung innerhalb und zwischen den Personalgruppen konzentriert hatte, geht es nun… mehr
Studiengänge vor und nach der Bologna-Reform. Vergleich von Studienangebot und Studiencurricula in den Fächern Chemie, Maschinenbau und Soziologie

Das Institut für Hochschulforschung hat in einer detaillierten Vergleichsanalyse Studiengänge in den Fächern Chemie, Maschinenbau und Soziologie an drei Universitätsstandorten vor und nach der Bologna-Reform untersucht. Die Studie zeigt, dass sich die Reformen weitgehend auf formale Aspekte beschränkt und kaum zu Neuerungen bei den Studieninhalten und Lehrformen geführt haben. Analysiert wurden das Studienangebot und der… mehr
Studiengänge vor und nach der Bologna-Reform (2009-2010)
Im Auftrag der Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI), einem Beratungsgremium der Bundesregierung, führte das Institut eine Untersuchung unter dem Titel „Qualitative Untersuchungen zur Umstellung der Studien-Curricula in Deutschland – Implikationen der gestuften Hochschul-Curricula auf die Innovationsfähigkeit Deutschlands“ durch. In der empirischen Studie wurden das Studienangebot und die Studiencurricula dreier Fächer an drei Universitäten vor… mehr