Lehrpersonal und Lehrqualität. Personalstruktur und Weiterbildungschancen an den Hochschulen Sachsen‐Anhalts

An den deutschen Hochschulen gehören Bemühungen zur Qualitätssteigerung der Hochschullehre seit geraumer Zeit zum institutionalisierten Konzept. Im Rahmen des BMBF‐Förderprogramms „Qualitätspakt Lehre“ ist auch der sachsen‐anhaltische Hochschulverbund „Heterogenität als Qualitätsherausforderung für Studium und Lehre (HET LSA)“ entsprechend aktiv. Dabei begreift er die Entwicklung von angemessenen Weiterqualifizierungsformen für Hochschullehrende als einen seiner Schwerpunkte. Die Hochschulen in… mehr
Wissenschaft mit Migrationshintergrund
Die rein quantitative Steigerung der Anteile von Studierenden mit Migrationshintergrund in den vergangenen Jahren lässt sich vor allem über den steigenden Anteil von Bevölkerungsteilen mit Migrationshintergrund erklären. Eine erfolgreiche Bildungsintegration kann dadurch noch nicht belegt werden. So nimmt mit jeder Karrierestufe der Anteil von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Migrationshintergrund ab. Dieses markiert illegitime Barrieren im… mehr
Heterogenität als Qualitätsherausforderung für Studium und Lehre. Ergebnisse der Studierendenbefragung 2013 an den Hochschulen Sachsen‐Anhalts

Die deskriptive Studie ermittelt den Stand der Heterogenität Studierender an den Hochschulen in Sachsen‐Anhalt. Hierfür wurden zwei Online‐Befragungen durchgeführt, die eine erhebbare Auswahl der Dimensionen studienrelevanter Heterogenität abbilden. Damit soll eine Informationsgrundlage geschaffen werden, die dem sachsen‐anhaltischen Verbundprojekt HET LSA bei der Identifizierung von Handlungsbedarfen in Studium und Lehre zur Orientierung dienen kann. Ausgehend von… mehr
die hochschule 2/2014: Diverses. Heterogenität an der Hochschule
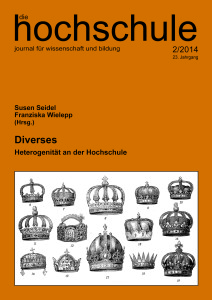
Diese Ausgabe der „hochschule“ widmet sich neben der Behandlung bekannter Heterogenitätsindikatoren einigen selten verhandelten Aspekten von Heterogenität. Sie stellt so den zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema eine Aufsatzsammlung zur Seite, die „gängige“ Fahrrinnen verlässt. Neben der analytischen Erschließung von Heterogenität werden auch Fragen der Handlungsmöglichkeiten behandelt. Dabei berücksichtigen die eingenommenen Perspektiven auf Hochschule vor allem reale… mehr
Wer lehrt warum? Strukturen und Akteure der akademischen Lehre an deutschen Hochschulen
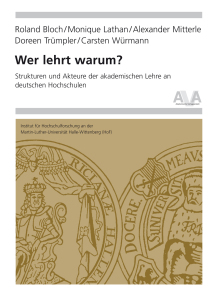
Wer lehrt eigentlich genau an deutschen Hochschulen – Professor/innen, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, Lehrbeauftragte? Und warum tun sie das? Um diese Fragen zu beantworten, haben die Autor/innen die Lehre und die Lehrenden eines Semesters an vier Universitäten und vier Fachhochschulen erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Konzentration auf die Professorenschaft in der Reformdiskussion nicht den Realitäten an… mehr
KoopL: Organisatorische Kontextoptimierung zur Qualitätssteigerung der Lehre
Neben curricularen Inhalten und didaktischer Vermittlung gibt es ein drittes Handlungsfeld für die Qualitätsentwicklung der Lehre (QdL) die Gestaltung ihrer organisatorischen Kontexte. Von 2014 bis 2017 widmet sich das Projekt „Organisatorische Kontextoptimierung zur Qualitätssteigerung der Lehre – Mobilisierung finanzierungsneutraler Ressourcen (KoopL)“ diesem Thema. Es wurde in der BMBF-Förderausschreibung „Begleitforschung zum Qualitätspakt Lehre“ eingeworben. Die Hauptuntersuchungsfrage… mehr
Qualitätsstandards für Hochschulreformen
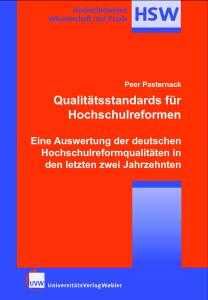
Nun müsse man noch „von der Studienreform zur Studienqualität“ gelangen, lautete 2012 das Resümee des Wissenschaftsrates nach über einem Jahrzehnt Bologna-Reform in Deutschland. Diese Einschätzung war insofern bemerkenswert, als in der Rhetorik des Bologna-Prozesses Studienreform und Studienqualität nahezu als Synonyme verstanden wurden. Vergleichbares lässt sich auch für andere Hochschulreformerfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte feststellen. Vor… mehr
Mission possible – Gesellschaftliche Verantwortung ostdeutscher Hochschulen
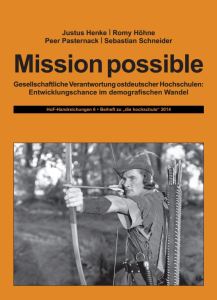
Entwicklungschance im demografischen Wandel Der demografische Wandel vollzieht sich regional selektiv und mit unterschiedlicher Intensität. Daraus ergibt sich eine Polarisierung in demografische Schrumpfungsgebiete einerseits und Wachstumszonen bzw. -inseln andererseits. Zu den Einrichtungen die im Vergleich institutionell sehr stabil sind zählen die Hochschulen. Sie verbürgen zudem Innovation und Zukunftsfähigkeit und können zur Bearbeitung demografisch induzierter Herausforderungen… mehr
Und der Zukunft zugewandt?
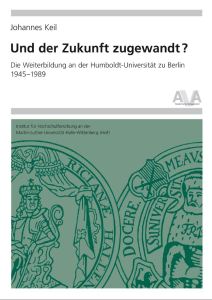
Die Weiterbildung an der Humboldt-Universität zu Berlin 1945-1989 Weiterbildung und lebenslanges Lernen haben sich zu bildungspolitischen Schlüsselwörtern entwickelt. Allerdings schlägt sich dies im Hochschulbereich bislang nicht in wirklich zupackenden Angeboten nieder. Einen Kontrastfall stellte diesbezüglich das DDR-Hochschulwesen dar: Zeitweise war dort in Wissenschaftszweigen wie zum Beispiel den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften mehr als die Hälfte aller Studierenden… mehr
Frühpädagogische Professionalisierung in Genderperspektive (ProPos)
In Fortsetzung der früheren Arbeiten zur elementarpädagogischen Ausbildung wird das Projekt im Rahmen des BMBF-Programms „Frauen an die Spitze“ 2011-2014 realisiert und unter den Förderkennzeichen 01FP1137 und 01FP1138 gefördert. In ihm werden in genderbezogener Perspektive die Prozesse der Professionalisierung in der Frühpädagogik unter Einbeziehung aller Ausbildungsstufen untersucht und ins Verhältnis zu ersten Wirkungen der Professionalisierungsentwicklungen… mehr
Elitebildung und Hochschulen
Die Hochschulbildung hat sich im Zuge der Bildungsexpansion von einer exklusiven Bildung zur Breitenbildung entwickelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein normaler Hochschulabschluss zu einer gesellschaftlichen Spitzenkarriere führt, hat sich dadurch verringert. Im Gegensatz zu der in Deutschland traditionellen „Gleichheitsfiktion“ aller Hochschulabschlüsse gleichen Typs tritt in jüngster Zeit eine kleine Zahl von Hochschulen mit dem Anspruch auf,… mehr
Zweckfrei nützlich: wie die Geistes- und Sozialwissenschaften regional wirksam werden. Fallstudie Sachsen-Anhalt
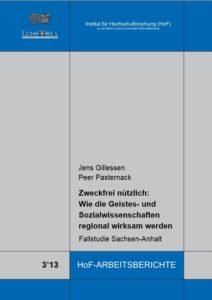
Die Frage nach regionalen Effekten der Geistes- und Sozialwissenschaften erscheint der Mehrheit ihrer Vertreter/innen suspekt. In der Tat: In kognitiver Hinsicht gibt es keine regionalen Geistes- und Sozialwissenschaften. Doch da es regionale Gebietskörperschaften sind, welche die Grundfinanzierung der Hochschulen tragen, sollte man auf die Frage nach regionalen Wirkungen vorbereitet sein. Um das etwas sperrige Thema… mehr
Eingänge und Ausgänge. Die Schnittstellen der Hochschulbildung in Sachsen-Anhalt
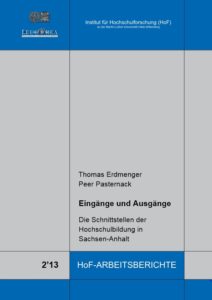
Mit der Eingangs- und der Ausgangsschnittstelle des Studiums sind die Hochschulen in die individuellen Biografien geschaltet und an das Schulsystem und das Beschäftigungssystem gekoppelt. Die Eingangsschnittstelle baut auf den Vorleistungen des Schulsystems auf, das die bildungsbiografischen Eingangsvoraussetzungen der Studienanfänger bestimmt. Das Schulsystem wiederum ist in hohem Maße von Bedingungen abhängig, die es nicht beeinflussen kann…. mehr
Studienerfolg und -abbruch in Sachsen-Anhalt
Das Kooperationsprojekt von HoF und WZW Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt ermittelte überregional Daten und Ursachen für Studienerfolg und -abbrüche und prüfte sie für die konkrete Situation in Sachsen-Anhalt. Da sich aus den amtlichen Daten keine individuellen Studienverläufe rekonstruieren lassen und zudem die Umstellungssituation auf das Bachelor-Master-System zu berücksichtigen ist, war dabei die Entwicklung neuer Berechnungsmethoden notwendig, um die… mehr
Studieren mit und ohne Abschluss. Studienerfolg und Studienabbruch in Sachsen-Anhalt
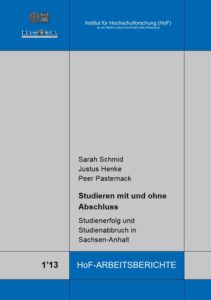
Der Report ermittelt erstmals für Sachsen-Anhalt hochschul- und fächergruppenspezifische Studienerfolgsquoten. Hierfür wird ein entsprechendes Berechnungsmodell entwickelt und angewandt. Daneben werden studienabbruchrelevante Problemlagen der Studierenden sowie abbruchgefährdete Studieren-dengruppen identifiziert und die Ursachen der Abbrüche an den Hochschulen eingegrenzt. Deutlich wird: Die Hochschulen Sachsen-Anhalts vermochten es, einen Zuwachs an Studierenden innerhalb von zehn Jahren um fast 50… mehr
Entwicklungen im Studiensystem
Unter der Überschrift „Entwicklungen im Studiensystem“ rangieren einige Projekte, die sich mit Fragen der Entwicklung des Studienangebots, der Gestaltung von Studiengängen, der Studienplatzvergabe einschl. der Studienwerbung, der hochschulinternen Organisation und Prozesse der Studienreform, der Akkreditierung und der Übergänge von Schule auf Hochschule beschäftigen. Aktueller Hintergrund ist der Bologna-Prozess, im Rahmen dessen das Studiensystem in Deutschland… mehr
Heterogenität als Qualitätsherausforderung: Hochschulbildung im demografischen Wandel

Im „Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre“ wurden elf Personalstellen mit Laufzeit bis 2016 eingeworben, darunter für Wittenberg eine Transferstelle „Qualität der Lehre“ mit drei Personalstellen. Im Rahmen eines Verbundantrages der sachsen-anhaltischen Hochschulen waren HoF und das Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt (WZW) Mitantragsteller. Die Transferstelle „Qualität der Lehre“ nahm, unterstützt von HoF, zum… mehr
„Dieser Hörsaal ist besetzt“. Protestformen in der Sicht von Studierenden der neuen und traditionellen Studiengänge. Ergebnisse einer quantitativ-empirischen Analyse

„Dieser Hörsaal ist besetzt“ ist in großformatigen Lettern auf einem Plakat über der Eingangstür zu lesen. Dies stellt jedoch nicht etwa einen Hinweis auf die aktuelle Raumauslastungssituation der Universität dar, sondern ist vielmehr als ein Indiz für eine Protestaktion der Studierenden zu deuten. In dieser Untersuchung haben 7.590 Studierende deutscher Hochschulen in einem schriftlichen Fragebogen… mehr
Analysen zu Studienangebot, Studienplatzvergabe, Studienwerbung und Studienkapazität (2011-2012)
Die dem Projekt zugrunde liegende These ist, dass die Kombination von Bologna-Studienreform, institutionellen Reformen an den Hochschulen und einem demografisch bedingten, regional unterschiedlich starken Rückgang der potenziellen Studienanfänger das Studiensystem mittel- und langfristig stärker wettbewerblich ausrichten wird. Hinweise hierfür können sein: Veränderungen des Studienangebots, Veränderungen in den Vergabe-, Zulassungs- und Auswahlverfahren sowie die Einführung bzw…. mehr
Studierende mit Migrationshintergrund und Interkulturalität im Studium
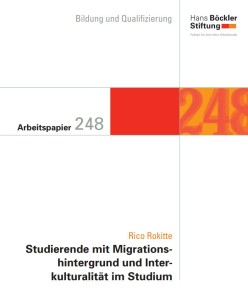
Die rein quantitative Steigerung der Anteile von Studierenden mit Migrationshintergrund in den vergangenen Jahren lässt sich vor allem über den steigenden Anteil von Bevölke-rungsteilen mit Migrationshintergrund erklären. Eine erfolgreiche Bildungsintegration kann dadurch noch nicht belegt werden. Entscheidend für den Erfolg von Fördermaßnahmen ist die Berücksichtigung der Diversität der Zielgruppe: Der unterschiedliche soziale Hintergrund und die… mehr