Die ostdeutschen Hochschulen und die zweite Phase des Aufbau Ost
Untersucht wurde die Entwicklungen der ostdeutschen Hochschulen von Mitte der 90er bis Mitte der 2000er Jahre. Ging es in der ersten Hälfte der 90er Jahre um die Gleichzeitigkeit von Abbau und Neuaufbau, so war anschließend die Dreifachherausforderung von Strukturkonsolidierung, Sparauflagenbewältigung und Hochschulreform im gesamtdeutschen Kontext zu bewältigen. Daher wird resümiert, wie es die ostdeutschen Hochschulen… mehr
Wissenschaftliche Weiterbildung im neuen Studiensystem – Chancen und Anforderungen. Eine explorative Studie und Bestandsaufnahme

Im Zuge des Bologna-Prozesses und lebenslangen Lernens hat die wissenschaftliche Weiterbildung an Bedeutung gewonnen, doch die Umsetzung der Reformen steckt noch in den An-fängen. Anhand einer qualitative Bestandsaufnahme zur Lage der wissenschaftlichen Weiterbildung an deutschen Universitäten gibt die Studie Aufschluss darüber, welche Anforderungen die Integration in das neue Studiensystem an die wissenschaftliche Weiterbildung stellt und… mehr
Studienqualität und Studienerfolg an sächsischen Hochschulen. Dokumentation zum „Hochschul-TÜV“ der Sächsischen Zeitung 2006

Zum siebten Mal erschien im November 2006 der auch „Hochschul-TÜV“ genannte vergleichende Studienführer Sachsen im Auftrag der Sächsischen Zeitung. Erstmals wird diese fünfseitige Presseveröffentlichung verbunden mit einer ausführlichen Dokumentation in Gestalt eines HoF-Arbeitsberichts. Der Bericht dokumentiert Stärken und Schwächen sowie die Entwicklung der Hochschullehre in Sachsen anhand wichtiger Kennzahlen wie Studierende, Studiendauer und Absolventenquoten. Insgesamt… mehr
Entwicklung der Studierwilligkeit

Das sechste Mal in Folge hat HoF Wittenberg – das Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg – die Studierwilligkeit in den Klassenstufen 10 und 12/13 an Gymnasien der neuen Bundesländer, in Niedersachsen und Berlin untersucht. Im Unterschied zu den neunziger Jahren und auch abweichend von anderen Bundesländern ist das Interesse an einem Studium… mehr
Studierwilligkeit und Studienverzicht in alten und neuen Bundesländern im Vergleich
HoF (und seine Vorgängereinrichtung) führt seit 1991 Untersuchungen zur Entwicklung der Studierwilligkeit anhand von Befragungen in den Klassenstufen 10 bis 12/13 an Gymnasien durch. Anfangs waren diese – mit Ausnahme von Berlin – auf das Gebiet der neuen Bundesländer konzentriert. Dabei war in Ansatz gebracht worden, dass hier zunächst keinerlei Daten vorlagen, die eine fortschreibende… mehr
Künftige Entwicklung der Studierendenzahlen in Sachsen-Anhalt. Prognosen und Handlungsoptionen
Die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt ist ähnlich wie die in den anderen neuen Bundesländern durch einen starken Rückgang der Geburten- und damit der Schülerzahlen gekennzeichnet. Wie wirkt sich das in den kommenden Jahren auf die Nachfrage nach Hochschulbildung aus? Wird allein dadurch, dass der Anteil der Studienberechtigten an den einzelnen Altersjahrgängen und auch der Anteil… mehr
Wissenschaftliche Weiterbildung im neuen Studiensystem
Im Zuge des Bologna-Prozesses hat die wissenschaftliche Weiterbildung an Bedeutung gewonnen. Lebenslanges Lernen und die Einführung gestufter Studiengänge werten die wissenschaftliche Weiterbildung auf, aber die Umsetzung der Studienreformen steckt noch in den Anfängen. Ziel der explorativen Studie ist eine qualitative Bestandsaufnahme der Lage der wissenschaftlichen Weiterbildung an deutschen Universitäten. Die Bestandsaufnahme soll Aufschluss darüber geben,… mehr
SZ-Hochschul-TÜV: Studienqualität und Studienerfolg an sächsischen Hochschulen
Zum siebten Mal erscheint im November 2006 der auch „Hochschul-TÜV“ genannte vergleichende Studienführer Sachsen im Auftrag der Sächsischen Zeitung. Erstmals wird diese fünfseitige Presseveröffentlichung verbunden mit einer ausführlichen Dokumentation in Gestalt eines HoF-Arbeitsberichts. Der Bericht dokumentiert Stärken und Schwächen sowie die Entwicklung der Hochschullehre in Sachsen anhand wichtiger Kennzahlen wie Studierende, Studiendauer und Absolventenquoten. Insgesamt… mehr
Entwicklung der Studierwilligkeit in den neuen und alten Bundesländern
Im Bericht sind Befunde zur Entwicklung der Studierwilligkeit in den neuen Bundesländern innerhalb der zurückliegenden drei Jahre in der Gegenüberstellung zu einem der alten Bundesländer (Niedersachsen) dargestellt. Im Mittelpunkt steht dabei neben der Entwicklung der Studierwilligkeit die Bedeutung von unterschiedlichen sozialen Einflussfaktoren sowie veränderten Bedingungen beim Zugang zu den Hochschulen (Studienabschlüsse, Auswahlverfahren, Studiengebühren). Die Befunde… mehr
Die Trends der Hochschulbildung und ihre Konsequenzen. Wissenschaftlicher Bericht für das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Republik Österreich

Gemäß der Ausschreibung durch das BMBWK sollte die Untersuchung folgende Fragestellungen in den Blick nehmen: Welche strukturellen Trends auf europäischer und insbesondere österreichischer Ebene resultieren aus den veränderten Rahmenbedingungen? Welche Kenntnisse und Kompetenzen werden aus gesellschaftlicher Perspektive von der Hochschulbildung erwartet? Welche unterschiedlichen Ansprüche stellen Studierende an Hochschulbildung? Welche Methoden wenden europäische und insbesondere österreichische… mehr
Zur künftigen Entwicklung der Studierendenzahlen in Sachsen-Anhalt – Prognosen und Handlungsoptionen. Expertise im Auftrag der Landesrektorenkonferenz von Sachsen-Anhalt

Im Auftrag der Landesrektorenkonferenz von Sachsen-Anhalt wurde am Institut eine Expertise erstellt, die künftige Entwicklungen der Studienanfänger- und Studierendenzahlen in Sachsen-Anhalt berechnet, begründet und Handlungsoptionen zur Stabilisierung der Hochschullandschaft des Landes aufzeigt. Ausgangspunkt dafür ist die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt, die ähnlich wie die in den anderen neuen Bundesländern durch einen starken Rückgang der Geburten-… mehr
Studiengebühren nach dem Urteil

Das Bundesverfassungsgericht hat am 26.1.2005 entschieden, dass der Bundesgesetzgeber mit der Regelung eines allgemeinen Studiengebührenverbotes über die Rahmengesetzgebungskompetenz, die ihm zu den allgemeinen Grundsätzen des Hochschulwesens zukommt, hinausgegangen sei. Im Gefolge dieser Entscheidung beginnt nunmehr ein konkurrenzföderalistischer Feldversuch: In diesem kann sich erweisen, welche Erwartungen und Befürchtungen, die sich mit der Einführung von Studiengebühren seit… mehr
Evaluation des SOKRATES II-Programms in Deutschland
Zentrale Fragestellungen der Evaluierung waren: (a) Werden die Ziele des Programms in Deutschland erreicht? (b) Welche Wirkungen hat das Programm bzw. haben seine Aktivitäten auf die beteiligten Individuen, Institutionen und das gesamte Bildungssystem in Deutschland? Weitere Fragestellungen bezogen sich auf die Relevanz des Programms für verschiedene Bildungssektoren und spezifizierte Zielgruppen sowie auf die Effizienz der… mehr
Entwicklungspotenziale institutioneller Angebote im Elementarbereich
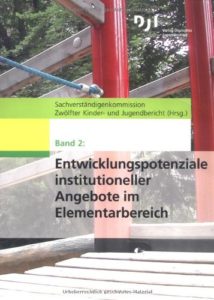
Das Thema des Zwölften Kinder- und Jugendberichts -„Bildung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule“- bestimmt auch die Konzeption der vier von der Sachverständigenkommission herausgegebenen Expertisenbände. So folgen die Texte in ihren inhaltlichen Zuschnitten den Schwerpunktsetzungen, die die Kommission der Bearbeitung des Berichtsauftrags zugrunde gelegt hat: Einerseits werden Lern- und Aneignungsprozesse von Kindern und… mehr
Mit SOKRATES II zum Europa des Wissens. Ergebnisse der Evaluation des Programms in Deutschland

SOKRATES soll zur Entwicklung eines Europa des Wissens beitragen. Zu diesem Zweck sind unter dem Dach von SOKRATES acht Aktionen in den Bereichen schulische, berufliche, hochschulische und Erwachsenenbildung zusammengefasst: COMENIUS, ERASMUS, GRUNDTVIG, LINGUA und MINERVA sowie drei ergänzende Aktionen. Die Evaluation ergab, dass die individuellen Teilnehmer/innen von den Programmen sehr profitieren, dass allerdings auf der… mehr
Hochschulexpansion in den Ländern West-, Mittel-, Osteuropas und den USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Untersucht werden die Expansion und die Kontraktion der Hochschulen in Europa und den USA im Zeitraum von 1950 bis 2000. Im Zentrum steht die Frage, wie sich die Beteiligung an der Hochschulbildung entwickelt hat und welche Gründe es dafür gibt. Dabei werden nicht, wie zumeist üblich, Fallstudien der Hochschulentwicklung einzelner Länder gegenübergestellt. Stattdessen werden Daten… mehr
Die Trends der Hochschulbildung und ihre Konsequenzen
Im Auftrag des österreichischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat eine Autorengruppe des Instituts für Hochschulforschung (HoF) an der Universität Halle-Wittberg die aktuellen Trends in der Hochschulbildung untersucht, die für die Zukunft zu erwartenden Trendentwicklungen prognostiziert, Zielkonflikte identifiziert, notwendige Änderungen im universitären Management und bei der Kompetenzentwicklung der Lehrenden bestimmt und 167 Handlungsempfehlungen formuliert.
Die deutsche Debatte um Studiengebühren
Über Für und Wider von Studiengebühren wurde in Deutschland seit Beginn der 90er Jahre mit zunehmender Intensität diskutiert. Nach der Jahrhundertwende führten einige Länder zunächst Gebühren für Langzeitstudierende und für Zweitstudien ein. 2007 begannen sieben Bundesländer – in denen ca. 70% aller an deutschen Hochschulen Immatrikulierten studieren –, auch Gebühren für das Erststudium zu erheben…. mehr
Hochschulentwicklung in Europa 1950-2000. Ein Datenkompendium
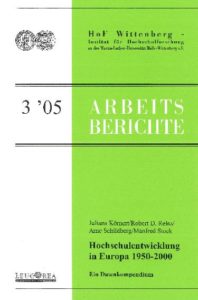
Das Datenkompendium präsentiert Zeitreihendaten (1950-2000) zur Hochschulentwicklung in Europa und in den USA. Die Daten wurden im Rahmen eines Forschungsprojektes erhoben, dessen Ziel es ist, die Hochschulexpansion bzw. -kontraktion in den europäischen Ländern und in den USA vergleichend zu untersuchen. Im Mittelpunkt des Kompendiums stehen einerseits Daten, die die Expansion bzw. Kontraktion der Hochschulen in… mehr
Passfähigkeit beim Hochschulzugang als Voraussetzung für Qualität und Effizienz von Hochschulbildung
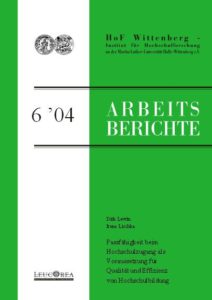
Der gesellschaftliche Druck auf die Hochschulen ist gestiegen, mehr Studierende in kürzerer Zeit erfolgreich zum Abschluss zu führen. Damit stellt sich die Frage, wie bereits der Hochschulzugang stärker darauf ausgerichtet werden kann. In einem historischen Rückblick werden frühere Ansätze zur Bestimmung von Voraussetzungen für ein Studium kritisch betrachtet. Gleichzeitig werden aktuelle Modelle beschrieben, mit denen… mehr