HoF-Lieferungen. Die Buchpublikationen des Instituts für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF)
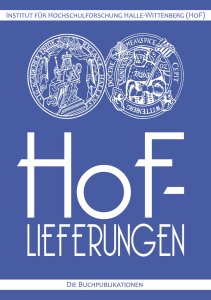
Die Forschungsarbeit des Instituts für Hochschulforschung spiegelt sich vor allem in den daraus entstehenden Publikationen wider. Unter diesen wiederum ragen die Monografien, Sammelbände, Themenhefte der Institutszeitschrift „die hochschule“ und Online-Dokumentationen heraus: Sie sind die wesentlichen geronnenen Ergebnisse der häufig mehrjährigen Projekte. Die soeben erschienene Broschüre „HoF-Lieferungen: Die Buchpublikationen“ stellt die seit 1997 erschienenen Veröffentlichungen, inhaltlich… mehr
Lebensqualität entwickeln in schrumpfenden Regionen. Die Demographie-Expertisen der Wissenschaft in Sachsen-Anhalt

Eines der wichtigsten endogenen Potenziale Sachsen-Anhalts stellt die ansässige Wissenschaft dar. Das gilt nicht nur hinsichtlich der Entwicklung von regionalen Innovationsstrukturen (FuE), sondern auch im Blick auf die Expertise zum demografischen Wandel und zur Raumentwicklung. Diese Bedeutung ergibt sich aus einem einfachen Umstand: Von außen wird die notwendige Expertise nicht im erforderlichen Umfang zu bekommen… mehr
BeMission: Die Third Mission in der Leistungsbewertung von Hochschulen

Das HoF führt zwischen 2013 und 2016 ein Forschungsprojekt durch, das im Rahmen des BMBF-Förderprogramms „Leistungsbewertung in der Wissenschaft“ gefördert wird. Leistungsbewertung in der Wissenschaft ist nichts prinzipiell Neues. Wettbewerb um individuelle fachliche Reputation und institutionelles Renommee kennzeichnet das akademische System seit alters her. Dennoch hat die Leistungsbewertung in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung… mehr
EU-Strukturfondsfinanzierung für wissenschaftliche Einrichtungen
Die EU-Strukturförderung soll von 2014 an auf die Ziele der EU-Strategie „Europa 2020“ ausgerichtet werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie wissenschaftliche Einrichtungen, insbesondere Hochschulen, zu intelligentem, nachhaltigem und inklusivem Wachstum in ihrer Sitzregion beitragen können. Welches sind Handlungsfelder, auf denen wissenschaftliche Einrichtungen hier aktiv werden können? Wie können wissenschaftliche Einrichtungen erfolgreich in… mehr
Jenseits der Metropolen – Hochschulen in demografisch herausgeforderten Regionen
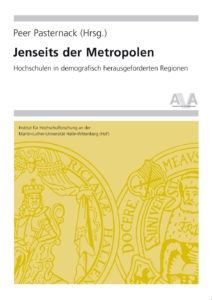
Im Mittelpunkt des HoF-Forschungsprogramms stehen seit einigen Jahren raumbezogene Fragen der Hochschul- und Bildungsentwicklung in demografisch herausgeforderten Regionen. Im Zuge der Entfaltung dieser Forschungs-linie sind zahlreiche Einzeluntersuchungen realisiert worden. Deren verstreut oder bisher noch nicht publizierte Ergebnisse wurden nun in einem Sammelband kompakt zusammengefasst. Eingangs geht es um die Wissenspotenziale der Nichtmetropolen, d.h. vor allem:… mehr
die hochschule 1/2013: Berufsfelder im Professionalisierungsprozess. Geschlechtsspezifische Chancen und Risiken

Die Soziale Arbeit, die Betreuung von Kleinkindern und die Geburtshilfe durch Hebammen und Geburtshelfer sind Tätigkeitsfelder, die eines gemein haben: Sie sind Gegenstand von Bemühungen um eine Professionalisierung. Im Zentrum der Professionalisierungsbemühungen steht die Etablierung neuer Studienangebote. Diese zielt nicht nur auf eine Qualitätssteigerungen in der beruflichen Praxis, sondern verfolgt zwei weitere Ziele: eine Attraktivierung… mehr
Konferenz „Entwicklungsperspektiven ostdeutscher Hochschulen im demografischen Wandel“ am 19.11.2013 in Berlin
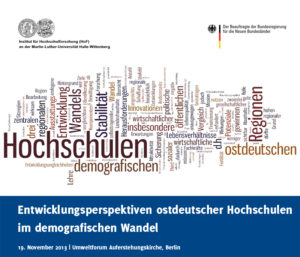
Am 19. November 2013 lädt das Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) zur Konferenz „Entwicklungsperspektiven ostdeutscher Hochschulen im demografischen Wandel“ im Berliner Umweltforum Auferstehungskirche ein. Im Zentrum stehen Anpassungsstrategien der Hochschulen in demografisch herausgeforderten Regionen. Zudem stellen einige Hochschulen ihre Handlungsansätze vor und es gibt Raum für Diskussionen und Erfahrungsaustausch.
mehr...Qualitätsstandards für Hochschulreformen
Nun müsse man noch „von der Studienreform zur Studienqualität“ gelangen, lautete das Resümee des Wissenschaftsrates nach über einem Jahrzehnt Bologna-Reform in Deutschland. Die so formulierte Erfahrung ist insofern bemerkenswert, als in der Rhetorik des Bologna-Prozesses Studienreform und Studienqualität nahezu als Synonyme verstanden wurden. Vergleichbares kann auch für andere Hochschulreformerfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte festgehalten werden…. mehr
Rebellion im Plattenbau: Die Offene Arbeit in Halle-Neustadt 1977-1983. Katalog zur Ausstellung
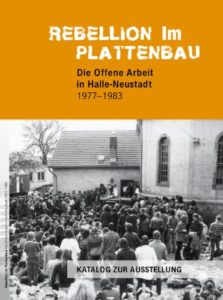
Die sozialistische Chemiearbeiterstadt Halle-Neustadt war ein Prestigeprojekt der DDR-Staatsführung. Ein bisher kaum bekanntes Kapitel dieses heutigen Stadtteils ist die „Offene Arbeit“ (OA) in der evangelischen Kirchengemeinde Halle-Neustadt von 1977 bis 1983. Es ist im Stadtgedächtnis faktisch nicht vorhanden. Daran sollen die Ausstellung, die erstmals im Juni / Juli 2013 im Evangelischen Gemeindezentrum Halle-Neustadt (Passendorf) gezeigt… mehr
HoF- und WZW-Berichte zu Studienerfolg im demographischen Wandel
Das Institut für Hochschulforschung (HoF) und das Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt (WZW) haben das Studienerfolgsgeschehen in Sachsen-Anhalt untersucht. Die Ergebnisse lassen sich vor dem Hintergrund bestehender demografischer Entwicklungen und der Vorleistungen des Schulsystems als Ausweis der Leistungsstärke der Hochschulen Sachsen-Anhalts bewerten. Zugleich sind damit Herausforderungen markiert, denen die Hochschulen in Zukunft begegnen werden. An mehreren Punkten erweisen… mehr
Website zum Projekt: Die Offene Arbeit in Halle-Neustadt 1977-1983
URL: https://oa-halle-neustadt.de Die Website wurde begleitend zu der zwischen 2013 und 2014 wandernden Ausstellung „Rebellion im Plattenbau. Die Offene Arbeit in Halle-Neustadt 1977-1983“ konzipiert. Sie vereint eine detaillierte Dokumentation der Geschichte der Offenen Arbeit mit Informationen zur Ausstellung und relevanten weiterführenden Publikationen. Es können außerdem die Exponate und der Katalog der Ausstellung eingesehen und heruntergeladen… mehr
Rebellion im Plattenbau. Die Offene Arbeit in Halle-Neustadt 1977–1983
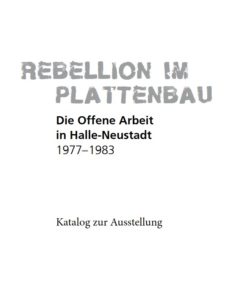
Die sozialistische Chemiearbeiterstadt Halle-Neustadt war ein Prestige–projekt der DDR-Staatsführung. Ein bisher kaum bekanntes Kapitel die-ses heutigen Stadtteils ist die „Offene Arbeit“ (OA) in der evangelischen Kirchengemeinde Halle-Neustadt von 1977 bis 1983. Es ist im Stadtgedächtnis faktisch nicht vorhanden. Daran sollen die Ausstellung, die erstmals im Juni/Juli 2013 im Evangelischen Gemeindezentrum Halle-Neustadt (Passendorf ) gezeigt wird,… mehr
Organisationsanalyse Universität Jena
Im Auftrag der FSU Jena führt HoF eine SWOT-Analyse für die Universität Jena durch. Die Identifikation, Analyse und Aufbereitung von (internen) Stärken und Schwächen sowie (externen) Chancen und Risiken unterstützt die Entwicklung einer langfristigen Zukunftsstrategie der FSU. Zentrale Publikationen nicht publiziert
Wissensgeschichte planstädtischer Agglomerationen: Das Beispiel Halle-Neustadt
1964 gegründet, weist Halle-Neustadt eine sequenzielle Doppelgeschichte auf: 25 Jahre DDR-Stadt und fast 25 Jahre Stadt(teil) im neuvereinten Deutschland. Im Zuge dessen wurde Halle-Neustadt zum doppelten Prototyp: erst der geplant expandierenden sozialistischen Stadt in der DDR und hernach der ungeplant schrumpfenden Stadt in Ostdeutschland. Beides war bzw. ist verbunden mit zwei verschiedenen symbolischen Stadtkonstruktionen, die… mehr
Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte
Seit 2005 führt das Institut für Hochschulforschung (HoF) gemeinsam mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur jährlich im Juni/Juli die Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte durch. Die Veranstaltung dient zwei Zielen: Erstens unterstützt sie die Einbindung der DDR-Forschung in die allgemeinen Standards, Trends und Konzeptionen deutscher und europäischer Zeitgeschichtsforschung nach 1945, die eines der vordringlichen Ziele… mehr
Frühpädagogische Professionalisierung in Genderperspektive (ProPos)
In Fortsetzung der früheren Arbeiten zur elementarpädagogischen Ausbildung wird das Projekt im Rahmen des BMBF-Programms „Frauen an die Spitze“ 2011-2014 realisiert und unter den Förderkennzeichen 01FP1137 und 01FP1138 gefördert. In ihm werden in genderbezogener Perspektive die Prozesse der Professionalisierung in der Frühpädagogik unter Einbeziehung aller Ausbildungsstufen untersucht und ins Verhältnis zu ersten Wirkungen der Professionalisierungsentwicklungen… mehr
Peer Pasternack, Prof. Dr.

Direktor des Institutes Lebenslauf 2011-14 Zusätzlich Wissenschaftlicher Leiter des Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt Lutherstadt Wittenberg (WZW) seit 2010 Direktor des Instituts für Hochschulforschung seit 2007 2. Vorsitzender des Campus Wittenberg e.V. seit 2006 Lehrveranstaltungen am Institut für Soziologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2004-2009 Forschungsdirektor des Instituts für Hochschulforschung 2002-2003 Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung im Senat von Berlin 1997-2002… mehr
OstHoch: Demografische Entwicklung und Perspektiven ostdeutscher Hochschulen
Im Auftrag des Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Länder wird untersucht, welche Auswirkungen der demografische Wandel auf die ostdeutschen Hochschulen hat und welche Handlungsmöglichkeiten die ostdeutschen Hochschulen zur Entwicklung ihrer Sitzregion haben. Gefragt wird danach, welche Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten von und für Hochschulen geeignete Anpassungsstrategien angesichts des demografischen Wandels darstellen; inwiefern die Bedarfslagen im… mehr
Zweckfrei nützlich: wie die Geistes- und Sozialwissenschaften regional wirksam werden. Fallstudie Sachsen-Anhalt
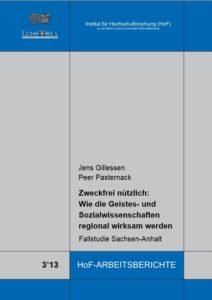
Die Frage nach regionalen Effekten der Geistes- und Sozialwissenschaften erscheint der Mehrheit ihrer Vertreter/innen suspekt. In der Tat: In kognitiver Hinsicht gibt es keine regionalen Geistes- und Sozialwissenschaften. Doch da es regionale Gebietskörperschaften sind, welche die Grundfinanzierung der Hochschulen tragen, sollte man auf die Frage nach regionalen Wirkungen vorbereitet sein. Um das etwas sperrige Thema… mehr
Regional gekoppelte Hochschulen. Die Potenziale von Forschung und Lehre für demografisch herausgeforderte Regionen
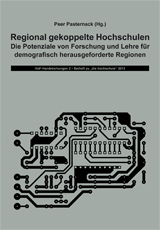
Hochschulressourcen haben eine zentrale Bedeutung für die Regionalentwicklung: Sie stellen hochqualifizierte Arbeitskräfte bereit, können system-, prozess- und produktbezogenes Problemlösungswissen erzeugen und ihre Sitzregionen an die globalen Wissensströme anschließen. Damit sind sie eine zentrale Voraussetzung, um die Resonanzfähigkeit ihrer Regionen für wissensbasierte Entwicklungen zu verbessern bzw. zu erhalten. Da aber Regional- und Hochschulentwicklungen unterschiedlich getaktet sind,… mehr