Soziologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: Dokumentation zum Zeitraum 1945 – 1991
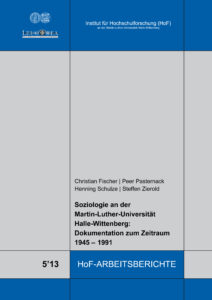
Die Dokumentation stellt einen Anhang zur Buchpublikation Peer Pasternack/Reinhold Sackmann (Hg.): Vier Anläufe: Soziologie an der Universität Halle-Wittenberg. Bausteine zur lokalen Biografie des Fachs vom Ende des 19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts, Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2013 dar. Dokumentiert werden hier Rechercheergebnisse zur Soziologie an der Martin-Luther-Universität seit dem Kriegsende bis zum Umbruch… mehr
9. Promovierendentage zu „Zeitzeugen und Geschichtswissenschaft“ 18. – 21.7.2013
Die 9. Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte sind dem Thema „Zeitzeugen und Geschichtswissenschaft“ gewidmet. Vom 18. bis 21. Juli 2013 sind auf Einladung des Instituts für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Doktoranden dazu eingeladen, sich in der Lutherstadt Wittenberg mit der Theorie und Praxis der Oral History zu befassen…. mehr
Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte
Seit 2005 führt das Institut für Hochschulforschung (HoF) gemeinsam mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur jährlich im Juni/Juli die Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte durch. Die Veranstaltung dient zwei Zielen: Erstens unterstützt sie die Einbindung der DDR-Forschung in die allgemeinen Standards, Trends und Konzeptionen deutscher und europäischer Zeitgeschichtsforschung nach 1945, die eines der vordringlichen Ziele… mehr
Soziologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1945-1990
Von 1947 und 1949 hatte es an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bereits ein Institut für Soziologie gegeben, doch eine eigentliche Institutionalisierung des Faches gelang erst 1965 mit der (1964 beschlossenen) Gründung einer eigenen Forschungsgruppe, dann „Wissenschaftsbereich marxistisch-leninistische Soziologie“ an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Dessen inhaltliche Schwerpunkte lagen in der Arbeits- und Industriesoziologie. 1976 startete ein eigenständiger Diplomstudiengang,… mehr
Wissenschaftliche Wissenschaftspolitikberatung. Fallstudie Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)
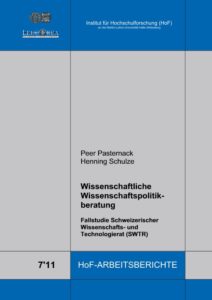
Wissenschaftsräte müssen fortwährend einen prinzipiellen Zielkonflikt verarbeiten: Einerseits erheben sie den Anspruch auf eine möglichst hohe Verbindlichkeit ihrer Stellungnahmen. Andererseits streben sie nach möglichst hoher Autonomie. Dieser Zielkonflikt ist grundsätzlich unauflösbar. Er kann nur prozessiert werden: Der Verbindlichkeitsanspruch ist nur durch Nähe zur Politik und Verwaltung zu realisieren. Der Anspruch auf Autonomie dagegen setzt die… mehr
8. Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte am 26./29.7.2012
Poster sind ein wichtiges Element der wissenschaftlichen Qualifizierung und entscheiden häufig über die Aufmerksamkeit, die einer Untersuchung zu teil wird. Um die Stärken und Schwächen dieser speziellen Darstellungsform zu kennen, bedarf es zunächst einschlägigen Wissens und Kompetenzen. In der Geschichtswissenschaft werden diese bisher nicht oder nur rudimentär vermittelt. Hier setzt der methodische Schwerpunkt der 8…. mehr
Promovierende veröffentlichen Podcasts zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte
Geschichte für die Ohren: Zwanzig Podcasts zu zeithistorischen Themen sind das Ergebnis der 7. Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte, die Anfang August zum siebten Mal gemeinsam vom Institut für Hochschulforschung und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur veranstaltet wurden. Die Podcasts umfassen ein breites Spektrum von lebens- und alltagsgeschichtlichen Zugängen, Fragen der aktuellen schulischen und medialen… mehr
Wissenschaftliche Wissenschaftspolitikberatung. Fallstudie Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)
Gesamtstaatliche Wissenschaftsräte sind mit Wissenschaftspolitikberatung befasst, setzen sich entweder ausschließlich oder zum Teil aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammen und haben fortwährend einen prinzipiellen Zielkonflikt zu prozessieren: zwischen dem Anspruch auf einen möglichst hohen Grad an Verbindlichkeit einerseits und dem Anspruch nach möglichst hoher Autonomie andererseits. Zugleich müssen sie Übersetzungsleistungen zwischen wissenschaftlicher, politischer und Verwaltungsrationalität erbringen…. mehr
7. Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte vom 4.-7.8.2011
Das Web 2.0 arbeitet sich langsam auch in die Geschichtswissenschaft vor (siehe u.a. http://www.histnet.ch/repository/hnwps/hnwps-02.pdf). Während sich die Zunft noch uneins darüber ist, welche Rolle sie den Neuen Medien bei der Verbreitung ihrer Erkenntnisse einräumen will, entwickeln sich diese in rasanter Geschwindigkeit weiter. Dem Erwerb von Kompetenzen zum Herstellen von content wird bisher in HistorikerInnenkreisen nur… mehr
Relativ prosperierend. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Die mitteldeutsche Region und ihre Hochschulen

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stellen in sozioökonomischer Hinsicht die leistungsstärkste Großregion Ostdeutschlands dar. Gemeinsam bezeichnen sich die drei Länder als „Region Mitteldeutschland“ und untermauern dies durch diverse länderübergreifende Kooperationen. Zusammen haben sie neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Innerhalb Ostdeutschlands lässt die mitteldeutsche Region am ehesten erwarten, bis zum Auslaufen des Solidarpakts II im Jahre 2019… mehr
Die frühpädagogische Ausbildungslandschaft. Strukturen, Qualifikationsrahmen und Curricula

Im frühpädagogischen Ausbildungssektor vollziehen sich dynamische Entwicklungen: Reformen in der Fachschulausbildung und Akademisierung unter Beteiligung sämtlicher Hochschultypen von Berufsakademie über FH und PH bis zur Universität. Diese Parallelentwicklungen wecken das Bedürfnis nach stärkerer Vergleichbarkeit. In struktureller Hinsicht stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Welche frühpädagogischen Ausbildungen werden aktuell angeboten? Welche internen Strukturen weist die frühpädagogische Ausbildungslandschaft… mehr
Frühpädagogische Ausbildung
In der elementarpädagogischen Fachdiskussion gilt es als dringend erforderlich, das in der Vorschulphase wirkende pädagogische Personal höher als bisher zu qualifizieren, d.h. nicht nur auf Fachschul-, sondern auch auf Hochschulebene auszubilden. Dem steht die Auffassung gegenüber, dass diese Höherqualifikation deutliche Kostensteigerungen zur Folge hätte. 2006 hat HoF eine bildungsökonomische Berechnung der Kosten, die sich aus… mehr
Hochschulen nach der Föderalismusreform
Zwischen den Hochschulsystemen der deutschen Bundesländer bestehen traditionell deutliche Unterschiede hinsichtlich des Finanzierungsinputs und des Forschungsoutputs. Die Föderalismusreform 2006 hatte den Anspruch erhoben, wettbewerbsföderalistische Aspekte im Hochschulwesen zu stärken – und damit sowohl den herkömmlichen kooperativen Föderalismus als auch die aktive Beteiligung des Bundes an der Hochschulentwicklung in den Hintergrund treten zu lassen. Im Projekt… mehr
6. Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte vom 22.-25. Juli 2010
Der jährliche Workshop für PromovendInnen zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte widmet sich in diesem Jahr den Methoden der Popularisierung fachwissenschaftlicher Erkenntnisse. Er wird gemeinsam vom Institut für Hochschulforschung (HoF) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Lutherstadt Wittenberg ausgerichtet. Bewerbungsschluss ist der 14. Juni. Zu Beginn der diesjährigen Veranstaltung wird zunächst ein… mehr
Fachkräfte bilden und binden. Lehre und Studium im Kontakt zur beruflichen Praxis in Ostdeutschland

Schon jetzt ist in einigen Beschäftigungssektoren ein deutlicher Fachkräftemangel spürbar, der sich in den kommenden Jahren vor allem in den ostdeutschen Bundesländern noch verstärken wird. Der Rentenübertritt der Transformationsgeneration innerhalb eines Zeitfensters von 15 Jahren fällt dort mit einer geringeren Studienneigung der Gymnasiasten, den Folgen des Geburtenknicks nach 1990 und einer anhaltenden Ost-West-Mobilität bildungs- und… mehr
Hochschule-Praxis-Netzwerke für Lehre und Studium in Ostdeutschland
In den ostdeutschen Bundesländern bahnt sich eine massive Fachkräftelücke an – in einigen Beschäftigungssektoren ist sie bereits heute spürbar. Der Rentenübertritt der Transformationsgeneration innerhalb eines Zeitfensters von 15 Jahren trifft auf eine Situation, die gekennzeichnet ist durch anhaltende Ost-West-Mobilität bildungs- und aufstiegsorientierter junger Menschen, eine geringe West-Ost-Mobilität in dieser Altersgruppe, eine im Vergleich zu den… mehr
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland: System, Förderwege, Reformprozesse (BuWiN I)
Das Forschungsprojekt widmet sich der umfassenden Analyse des Nachwuchsförderungssystems in Deutschland. Ausgangspunkt ist die aktuelle hochschulpolitische Diskussion zur Nachwuchsqualifizierung in Deutschland mit Juniorprofessur, Exzellenzinitiative und Hochschulpakt 2020 sowie den Konsequenzen der Föderalismusreform. Vor dem Hintergrund dieser Debatte werden die Promotionsphase und die Post-doc-Phase ausführlich beleuchtet. In jeweils einem historischen Rückblick wird aufgezeigt, wie das gegenwärtige… mehr
Wagnis Wissenschaft. Akademische Karrierewege und das Fördersystem in Deutschland

In dem Band wird das System der Nachwuchsförderung in Deutschland umfassend erläutert. Ausgangspunkt ist die aktuelle hochschulpolitischen Diskussion zur Nachwuchsqualifizierung in Deutschland mit Juniorprofessur, Exzellenzinitiative und Hochschulpakt 2020 sowie den Konsequenzen der Föderalismusreform. Vor dem Hintergrund dieser Debatte werden die Promotionsphase und die Post-doc-Phase ausführlich analysiert. In jeweils einem historischen Rückblick wird aufgezeigt, wie das… mehr
Stabilisierungsfaktoren und Innovationsagenturen. Die ostdeutschen Hochschulen und die zweite Phase des Aufbau Ost

Ging es in der ersten Hälfte der 90er Jahre um die Gleichzeitigkeit von Abbau und Neuaufbau, so ist seither die Dreifachherausforderung von Strukturkonsolidierung, Sparauflagenbewältigung und Hochschulreform im gesamtdeutschen Kontext zu bewältigen. Die Untersuchung resümiert, wie es die ostdeutschen Hochschulen vermocht haben, ihre Strukturen zu konsolidieren, und wie sie sich in den allgemeinen Hochschulreformentwicklungen platzierten und… mehr
Die ostdeutschen Hochschulen und die zweite Phase des Aufbau Ost
Untersucht wurde die Entwicklungen der ostdeutschen Hochschulen von Mitte der 90er bis Mitte der 2000er Jahre. Ging es in der ersten Hälfte der 90er Jahre um die Gleichzeitigkeit von Abbau und Neuaufbau, so war anschließend die Dreifachherausforderung von Strukturkonsolidierung, Sparauflagenbewältigung und Hochschulreform im gesamtdeutschen Kontext zu bewältigen. Daher wird resümiert, wie es die ostdeutschen Hochschulen… mehr