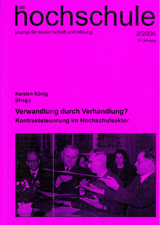|
Archiv "die hochschule" Archiv "hochschule ost" |

Sigrun Nickel, Anna-Lena Thiele
Welche Impulse können Erkenntnisse aus der Forschung den Hochschulen für ihre eigene Weiterentwicklung geben? Diese Frage steht im Mittelpunkt der neuen Ausgabe der „hochschule“. Damit das zur Verfügung stehende Wissen auf der Handlungsebene wirksam werden kann, sind geeignete Formen des Theorie-Praxis-Transfers notwendig. Umgekehrt ist es aber genauso wichtig, dass die Praxis ihrerseits Impulse in die Forschung einbringen kann und der Wissenstransfer somit zu einem Austauschprozess wird. Auch hierzu gibt das vorliegende Heft Anregungen. |
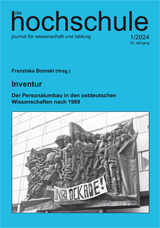
Über den Grad der Repräsentanz von Ostdeutschen in herausgehobenen gesellschaftlichen Positionen wird seit langem, aber aktuell besonders intensiv öffentlich debattiert. Häufig liegt diesen ein eher diffuses Wissen über die komplexen Vorgänge, die unter dem Schlagwort „Elitenaustausch“ subsummiert werden, zugrunde. Daher nahm sich eine Tagung des Potsdamer Einstein Forum im Januar 2023 des Themas an. Die aktuelle Forschung, Zeitzeug.innen aus Ost und West wie auch verschiedene Generationen sollten miteinander ins Gespräch gebracht werden. Die Beiträge werden hier dokumentiert. Sie schreiten das Feld schlaglichtartig vom Allgemeinen zum Besonderen in einzelnen Fächern ab. |

In diesem Heft liegt der Schwerpunkt auf den Rollen von Wissenschaftsmanagement und -kommunikation im Wissenschaftssystem. Das Heft ist zugleich eine Zwischenbilanz des Graduiertenkollegs „WiMaKo“. Einleitend wird dafür eine Perspektive als miteinander verwobene Schnittstellen entwickelt. Das BMBF-Graduiertenkolleg „Wissenschaftsmanagement und Wissenschaftskommunikation als forschungsbasierte Praxen der Wissenschaftssystementwicklung“ (WiMaKo) – betrieben von Uni Magdeburg, HoF und Uni Speyer – hat eine Zwischenbilanz vorgelegt. Sie widmet sich Fragen der organisationalen Bearbeitung wissenschaftsexterner Anforderungen an das Wissenschaftssystem. Die Beiträge stammen von den Kollegiat.innen. |

Wo das Thema Hochschulbildung und Pandemie ausgewertet wird, dort stehen bislang die naheliegenden, weil überoffensichtlichen Fragen im Mittelpunkt: Digitalisierung der Lehre, Distanzunterricht und dessen Akzeptanz, technische Ausstattungen bzw. deren Defizite oder die Bedeutung von Sozialität und Soziabilität für Lehr-Lern-Prozesse. Das kann kaum verwundern. Es waren neue Erfahrungen wie die flächendeckende Kommunikation unter Abwesenden mit dem Zwang zur Kacheldidaktik, die zunächst einmal die alltagsprägenden Herausforderungen darstellten. Doch dürfte es ebenso sinnvoll sein, diese Themen in einen Horizont mittlerer Reichweite einzuordnen. |

Die Vielzahl von wissenschaftlichen Einrichtungen, Forscher.innen, Themen, Projekten und Publikationen der Hochschul- und Wissenschaftsforschung zeigt: Das Feld hat sich im Laufe der Jahre dynamisch entwickelt. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wurden daher im Projekt „Topografie der Wissenschafts- und Hochschulforschung“ (WiHoTop) systematisch Angehörige und Forschungseinrichtungen des Doppel-Feldes erfasst. Dazu sind relevante Informationsportale, Fachgesellschaften, intermediäre Institutionen, Literaturdatenbanken sowie soziale Netzwerke auf Grundlage eines reflektierten Kriterienkatalogs ausgewertet worden. Die Ergebnisse werden in diesem Themenheft publiziert. |

Das themenoffene Heft enthält u.a. einen Beitrag, in dem die hohen Erwartungen an deutsch-chinesische Wissenschaftskooperationen mit den konkreten Kooperationserfahrungen deutscher Wissenschaftler.innen kontrastiert werden. Angesichts pandemiebedingter Partizipationsmüdigkeit sei hier auch auf den Beitrag hingewiesen, der studentische Protestbewegungen in einem langen zeitlichen Bogen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart analysiert. |

Die gesellschaftliche Wirkmächtigkeit der Wissenschaft beginnt nicht erst dort, wo von Hochschulpolitik und Wissenschaftsmanagement der Transfer wissenschaftlichen Wissens in praktische Handlungsfelder aktiv befördert wird. Vielmehr ist sie der Hochschulbildung vielmehr inhärent. Am Beispiel der Sozialen Arbeit zeigen die Beiträge des Themenschwerpunkts, ob und wie sich die Transformation von theoretischem in ein praxis- und handlungsbezogenes Wissen vollzieht. Beleuchtet werden dabei auch die Gründe für die vielfältigen Grenzen des Transfers und der aktiven Einwirkung der Wissenschaft auf die Praxis gesellschaftlicher Handlungsfelder. |

Sandra Beaufays / Anja Franz / Svea Korff (Hg.) Üblicherweise gilt der Abschluss einer Promotion als Start einer akademischen Laufbahn. Heute ist sie nur noch eine Eintrittsbedingung unter vielen. An diesem Punkt erfolgt – mit und ohne erfolgreichen Abschluss – oftmals ein Ausstieg aus der Wissenschaft. Dieser kann keineswegs unter den Begriff „Scheitern“ subsummiert werden, sondern muss als vielschichtiger Prozess mit hilfreichen, aber auch erschwerenden Begleitumständen verstanden werden. Um strukturelle Bedingungen, die bspw. einen geplanten Ausstieg deutlich vereinfachen, bereitstellen zu können, müsste sich an Hochschulen jedoch einiges ändern. |

Annett Maiwald / Annemarie Matthies / Christoph Schubert (Hg.) Das Schwerpunktheft der „hochschule“ zur Akademisierung zeigt, wie auf verschiedenen Ebenen des Hochschulsystems mit der Bildungsexpansion nicht nur umgegangen, sondern diese auch genutzt und sogar selbst gefördert wird – nicht zuletzt dadurch, immer neue Themenfelder zu erschließen und zum Gegenstand eines akademischen, letztlich curricularisierbaren Interesses zu erheben. Dies bleibt nicht ohne Rückwirkungen auf die beruflichen Handlungsfelder. |

Diese Ausgabe der Zeitschrift „die hochschule“ vereint Aufsätze u.a. zu Fragen der wissenschaftsbezogenen Krisenkommunikation, der Messung von Professionalisierung, den Trends der Hochschulfinanzierung sowie der Hochschul- und Wissenschaftsgeschichte. . |

Daniel Hechler / Peer Pasternack(Hg.) Innen und Außen des Hochschulsystems stellen eine sehr manifeste Grenze dar. Da beide jedoch über Finanzierung, Rechtsetzung, Legitimationsbedarfe und zertifikatsgebundene Berechtigungsstrukturen strukturell gekoppelt sind, ist diese Grenze zu bewirtschaften. Das geschieht, wie auch sonst, konflikthaft: in der Gegenüberstellung von Gesellschaft und Wissenschaft, in der Konkurrenz von Qualitäts- und Relevanzorientierung der Wissenschaft und den wahlweise ver- oder entschärfenden Bemühungen, diese Anordnungen steuernd in den Griff zu bekommen. Wie die Bewirtschaftung der Binnen- und Außengrenzen an Hochschulen ge- und misslingt, behandelt die neue Ausgabe der „hochschule“. |
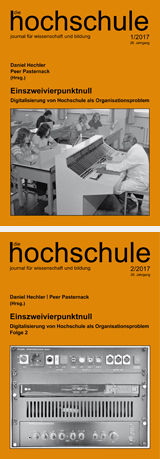
Daniel Hechler / Peer Pasternack (Hg.) Digitalisierung verändert das Zusammenleben auf sozialer, politischer und wirtschaftlicher Ebene. Diese Medienrevolution, die sich mit der Durchsetzung der Wissensgesellschaft verbindet, stellt die Organisation Hochschule vor neuartige Herausforderungen. Wie dabei die Organisation die Digitalisierung limitiert bzw. die Digitalisierung Organisationswandel erfordert, steht im Mittelpunkt der neuen „hochschule“. Zentral ist die ganzheitliche Betrachtung elektronischer Hochschulökosysteme, die eingebettet wird einerseits in den Rahmen eines sich digital entgrenzenden Wissenschaftssystems, andererseits in die Betrachtung der Hochschule als ‚schwieriger‘ Organisation. |

Peter Tremp / Sarah Tresch (Hg.) Akademische Freiheit gehört zu den ‚core values‘ von Hochschulen. Sie bildet einen zentralen berufsethischen Referenzpunkt in Forschung, Lehre und Studium. Da die akademische Freiheit jedoch nicht immer umfassend gelten kann und in komplexen Situationen oftmals strapaziert werden muss, bleibt sie stets in der Diskussion: Trotz langer Tradition ist sie in der konkreten Auslegung umstritten – und wird immer wieder als bedroht erlebt. Dies gilt nicht zuletzt im Kontext des Bologna-Prozesses, bei Fragen der Finanzierung oder der institutionellen und inneren Unabhängigkeit. Diesem Spannungsfeld widmet sich diese Ausgabe der „hochschule“. |
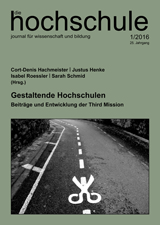
Cort-Denis Hachmeister / Justus Henke / Hochschulen produzieren über ihre Kernmissionen in Lehre und Forschung hinaus wertvolle Beiträge für die Gesellschaft. Diesen Leistungen der Hochschulen – ihrer Third Mission – widmet sich das gemeinsam vom HoF und CHE herausgegebene Heft der „hochschule“. Beleuchtet werden zum einen die veränderten Rahmenbedingungen des Wissenschaftssystems, die eine größere Resonanzfähigkeit der Hochschulen für gesellschaftliche Aufgaben erforderlich machen. Zum anderen weisen bisherige Versuche, die Third Mission von Hochschulen zu erfassen, große Defizite auf. Daher werden Möglichkeiten sondiert, diese Leistungen besser zu dokumentieren und für Bewertungen zugänglich zu machen. |

Marion Kamphans / Sigrid Metz-Göckel / Margret Bülow-Schramm (Hg.) Hochschulen folgen einem wissenschaftlichen Ethos. Dennoch werden gerade die Verletzungen der damit verbundenen Normen im Alltag kaum kritisch hinterfragt, sondern oftmals tabuisiert. Diesen Tabuisierungen spüren die Beiträge des Themenschwerpunkts in vielen Feldern des Hochschul- und Wissenschaftsbetriebs nach. |

Daniel Hechler / Peer Pasternack (Hg.) Auch 25 Jahre nach ihrem Ende weckt die Hochschul- und Wissenschaftsgeschichte der DDR nicht nur das Interesse der Zeitzeugen, sondern auch von seinerzeit an ihr Nichtbeteiligten. Davon zeugt nicht zuletzt die Vielzahl einschlägiger Dissertationen von NachwuchswissenschaftlerInnen. Wie lebendig dieses Themenfeld ist, verdeutlicht der Schwerpunkt dieses Heftes. Dafür wurden Autorinnen und Autoren von jüngeren Untersuchungen eingeladen, ihre zentralen Ergebnisse zusammenzufassen. Der Themenschwerpunkt präsentiert mithin einen Querschnitt durch aktuelle Forschungen zur DDR-Hochschul- und Wissenschaftsgeschichte, deren Themen nach wie vor nicht erschöpft sind. |
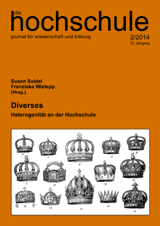
Susen Seidel / Franziska Wielepp (Hg.) Diese Ausgabe der "hochschule" widmet sich neben der Behandlung bekannter Heterogenitätsindikatoren einigen selten verhandelten Aspekten von Heterogenität. Sie stellt so den zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema eine Aufsatzsammlung zur Seite, die „gängige“ Fahrrinnen verlässt. Neben der analytischen Erschließung von Heterogenität werden auch Fragen der Handlungsmöglichkeiten behandelt. Dabei berücksichtigen die eingenommenen Perspektiven auf Hochschule vor allem reale Gegebenheiten und weniger ideal gedachte Konstellationen. |
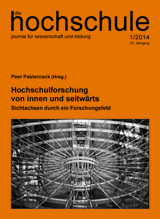
Peer Pasternack (Hg.) Der Wissenschaftsrat hat im April ein Papier zur Hochschul- und Wissenschaftsforschung publiziert. Im Vorfeld dazu hatte sich die Hochschulforschung mit analytischen Selbstbeschreibungen positioniert. Im Nachgang lagen Kommentare des Wissenschaftsrats-Papiers nahe. Zur Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung in Dortmund vom 25.-27.6.2014 liegen die Texte nun gedruckt vor. |

Diese Ausgabe der Zeitschrift „die hochschule“ vereint Aufsätze u.a. zu Fragen des Hochschulmanagements, der Studienorganisation sowie der DDR-Hochschulgeschichte. |

Jens Gillessen / Johannes Keil / Peer Pasternack (Hg.) Mit der Akademisierung von Ausbildungen verbinden sich Hoffnungen auf eine geschlechtliche Durchmischung bisheriger ‚Frauenberufe‘. Doch zeigt die Erfahrung, dass neu entstehende Führungspositionen überproportional von Männern besetzt werden, während unterprivilegierte Positionen den Frauen zufallen. Der Themenschwerpunkt der „hochschule“ fragt, wie sich die Herausbildung solcher Geschlechterhierarchien verhindern lässt. |
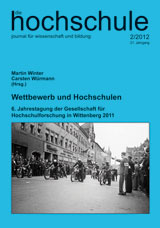
Martin Winter / Carsten Würmann (Hg.) Wettbewerb hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Leitvorstellung im Hochschulbereich entwickelt. Nicht nur im hochschulpolitischen Diskurs rangiert er unter den zentralen Topoi, sondern auch in der Praxis: Immer mehr Verfahren werden eingesetzt, die einen Wettbewerb zwischen und in den Hochschulen zu erzeugen suchen, der für Effizienz-, Leistungs- und Qualitätsgewinne sorgen soll. Den vielfältigen Erscheinungen und verschiedenartigen Aspekten des Wettbewerbs im Hochschulbereich widmete sich die sechste Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung in Wittenberg, die das Institut für Hochschulforschung (HoF) in Wittenberg vom 11. bis 13. Mai 2011 ausgerichtet hatte. Die aktuelle Ausgabe der „hochschule“ widmet sich in 17 Beiträgen den Verfahren und Effekten des Wettbewerbs für Forschung und Lehre, akademische Karriere sowie die Steuerung von Hochschulen. |

Daniel Hechler / Peer Pasternack Die Hochschulforschung ist zunehmend mit der Nachfrage nach konkreten fallbezogenen Organisationsanalysen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund wurde eine systematische Aufbereitung der Wissens- und Erfahrungsvoraussetzungen unternommen, auf deren Grundlage die Hochschulforschung eine solche Nachfrage bedienen kann. Was die Hochschulforschung an Vorratswissen in die konkrete Analyse von Hochschulorganisationen einbringt, wurde in Gestalt der zentralen Erklärungsthesen der theoriegenerierenden Hochschulorganisationsforschung gemustert und aufbereitet. Im Anschluss daran der ließen sich anwendungsfallgebundene Hochschulorganisationsanalysen betrachten. Dabei wurde der Projekttyp in den Mittelpunkt gerückt, der heutzutage typisch ist: extern beauftragt und ressourcenknapp, aber dennoch – aus Sicht der Auftraggeber – möglichst umfänglich, tiefensondierend und weiträumige Kontexte einbeziehend, auf dass möglichst kein Aspekt ungeklärt bleibe. Im einzelnen geht es dabei um die Funktionen solcher Analysen, um die in diesem Feld bestehende Expertisekonkurrenz, praktisch-organisatorische Aspekte (Ressourcen, Rolle der Auftraggeber, Informations- und Quellenlage), Umsetzungsprobleme und -problemlösungen einschließlich Analysewerkzeuge, schließlich die Möglichkeiten, wie sich Bewertungen und Empfehlungen formulieren lassen, ohne die Grenze zwischen Analytiker und Akteur diffus werden zu lassen. Bei all dem erfolgt eine lebensnahe Auswertung, die sich auf mögliche Konflikte und praktische Probleme konzentriert, welche in Hochschulorganisationsanalysen auftauchen können. Ebenso wird durchgehend die Frage nach niedrigschwelliger, adressatenorientierter Analyse- und Ergebnisdarstellung berücksichtigt. |

Karsten König / Rico Rokitte (Hg.) Mit jeder Karrierestufe nimmt der Anteil von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Migrationshintergrund ab. Dieses markiert illegitime Barrieren im Wissenschaftssystem, die die Erfolgsaussichten nicht allein von wissenschaftlicher Leistung, sondern auch von regionaler, kultureller und sozialer Herkunft abhängig machen. Seit einigen Jahren rückt dieser Einfluss der Herkunft auf Bildungs- und Berufschancen in das politische und wissenschaftliche Interesse. Mit dem Begriff „Migrationshintergrund“ wird versucht, das Phänomen zu beschreiben und z.B. auch in der Statistik messbar zu machen. Allerdings zeigt ein differenzierterer Blick, dass mit diesem Begriff sehr unterschiedliche Bedingungen beschrieben werden, die kaum als übergreifendes Merkmal angesehen werden können: Zahlreiche Operationalisierungen der theoretischen und empirischen Ansätze in der Bildungsforschung richten ihre Aufmerksamkeit auf einen je anderen Personenkreis, und zwar nicht nur hinsichtlich des Migrationsstatus, sondern auch bezüglich der Position in der akademischen Welt. Das aktuelle Heft „die hochschule“ strukturiert diese Debatte, zeigt verschiedene Zugänge zu den vorliegenden Daten und stellt qualitative Studien vor, die nach den Gründen für die oben beschriebene Entwicklung suchen. Ergänzend wird beispielhaft aufgezeigt, wie die Hochschulen selbst zu mehr Chancengerechtigkeit in der Wissenschaft beitragen können. |

Edith Braun / Katharina Kloke / Christian Schneijderberg (Hg.) Fragestellungen der Hochschulforschung können zum einen multi-/interdisziplinär, zum anderen aber auch durch spezifische disziplinäre Sichtweisen bearbeitet werden. Somit wird bei der Erforschung des Gegenstands Hochschule oder eines bestimmten Ausschnitts von Hochschule – etwa Forschung, Lehre oder Hochschulplanung – ein Forschungsfeld betreten, das sich durch die Verbindung von Methoden, Theorien, Erkenntnissen und Wissen aus verschiedenen Disziplinen speist und von der Ergänzung und Verbindung der disziplinären Zugänge lebt. Bietet die Verbindung mehrerer Disziplinen den Vorteil, die Breite des Forschungsgegenstandes Hochschule abzudecken, so leisten disziplinäre Zugänge ein genauere Fokussierung auf spezifische Aspekte. Das Heft stellt grundlegend die disziplinären Zugänge der Erziehungs-, Geschichts-, Rechts-, Politik- und Wirtschaftswissenschaft sowie der Psychologie und Soziologie zur Hochschulforschung vor. Dank seines Handbuchcharakters ermöglicht es nicht nur einen grundlegenden Einblick in die Beiträge der genannten Disziplinen zur Hochschulforschung, sondern beleuchtet zugleich den verbindenden Beitrag der verschiedenen Disziplinen zur Erforschung des Gegenstands Hochschule. |
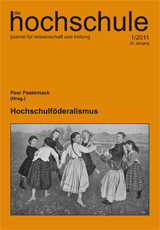
Peer Pasternack (Hg.) Vor der Föderalismusreform 2006 wurde überwiegend das Bild eines zwar föderal verfassten, aber weitgehend homogenen Hochschulwesens in Deutschland gezeichnet. Mit der Reform auferlegten sich die Länder einen Qualitätswettbewerb, der explizit auf föderale Differenzierung setzt. Die sozialwissenschaftliche Hochschulforschung hat sich lange zurückhaltend bezüglich föderalismusspezifischer Analysen verhalten. Vielfach wurde vereinfachend ein einheitliches ‚deutsches Hochschulsystem‘ als gegeben unterstellt. Diese Betrachtungsweise lässt sich so nicht mehr aufrecht erhalten. Es stellen sich jetzt neue Fragen: nach föderaler Verwettbewerblichung, nach Differenzierung mit sechzehn je eigenen Hochschulsystemen oder nach verstärkter Bezugnahme aufeinander mit dem Ergebnis dann doch wieder eintretender Homogenisierung. Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich die aktuelle Ausgabe der „hochschule“. Beleuchtet wird dabei nicht allein der deutsche Hochschulföderalismus: Über die Darstellung des schweizerischen und kanadischen Bildungsföderalismus findet zudem eine international vergleichende Kontextualisierung der deutschen Entwicklungen statt. |

Carsten Würmann / Karin Zimmermann (Hg.) „Ein besonders grausames Relikt der Bildungsexpansion“ sei sie, ein „Stück Planwirtschaft“, „das es bis in die Gegenwart von Exzellenzinitiative und Bologna-Reform geschafft hat“. Die so kritisierte Kapazitätsverordnung (KapVO) und die Kapazitätsplanung nach Curricularnormwerten (CNW) waren in den 1970er Jahren eingeführt worden, um die Vergabe stark nachgefragter Studienplätze so zu organisieren und zu reglementieren, dass die Auswahl das grundgesetzlich gesicherte Teilhaberecht an beruflichen Lebenschancen ausreichend berücksichtigte. Heute gelten sie den einen als eine der letzten verbliebenen Möglichkeiten zu einer bundeseinheitlichen Bildungsplanung und als Garanten gleicher Lehr- und Lernverhältnisse, während sie für andere bürokratische Monstren darstellen, die den Wettbewerb zwischen den Hochschulen verhindern und somit selbst einen gravierenden Teil der aktuellen Probleme des bundesdeutschen Hochschulsystems ausmachen. |
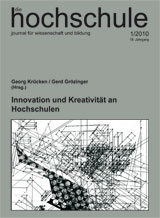
Georg Krücken / Gerd Grözinger (Hg.) 2009 war - vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union so ausgerufen - das "Europäische Jahr der Kreativität und Innovation". Die Notwendigkeit, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, wird auch innerhalb der Gemeinschaft der Hochschulforscherinnen und -forscher gesehen. Entsprechend stellte die Gesellschaft für Hochschulforschung ihre Jahrestagung 2009, die im April an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer stattfand, unter das Thema "Innovation und Kreativität an Hochschulen: Ihre Bedeutung für Lehre, Organisation und Forschung". Eine Auswahl der Beiträge wird im Themenschwerpunkt dieses Heftes publiziert, wobei alle drei Dimensionen – Lehre, Organisation, Forschung – repräsentiert sind. |

Daniel Hechler / Peer Pasternack (Hg.) Hinsichtlich des Bologna-Prozesses lassen sich zwei Dinge festhalten: Zum einen ist die Einführungsphase der Studienstrukturreform aktuell im Begriff, zum Abschluss zu gelangen. Damit ergibt sich die Chance, in die Bologna-Reparatur-Phase zu wechseln. Weil zum anderen fast jede Bologna-Folgekonferenz den bereits bestehenden zusätzliche Ziele hinzufügte, sind den ursprünglichen Zentralanliegen des Bologna-Prozesses unterdessen eine Reihe von Sonderaspekten zur Seite getreten. Diese stehen häufig nicht im Mittelpunkt der Reformaufmerksamkeit, werden teils ‚nebenher’ mit bearbeitet, teils allein von Interessengruppen vorangetrieben. Das vorliegende Heft widmet sich in neun Einzelbeiträgen genau solchen Aspekten, die sonst eher am Rande verhandelt werden. |
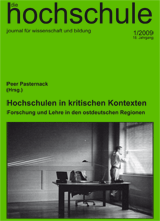
Peer Pasternack (Hg.) Kontexte der Hochschulentwicklung sind gesellschaftliche Strukturen, das wirtschaftliche Umfeld und kulturelle Rahmenbedingungen, aber auch demografische Entwicklungen oder außerhochschulische Wissenschaftsstrukturen. Aktuell unterliegen diese Kontexte in Ostdeutschland – und mittelfristig auch in Gesamtdeutschland – einem Prozess, der unter dem Begriff der „Schrumpfung“ (genauer: der Schrumpfung der Bevölkerungszahlen) zusammengefasst wird. Das wiederum bedeutet für Hochschulen mehr, als es die landläufige Fokussierung auf die Größe künftiger Studienanfängerkohorten nage legt. Es verändert einerseits die Entwicklungskontexte der Hochschulen; andererseits steigt die Bedeutung der Hochschulen für regionale Entwicklungen. |

Robert D. Reisz / Manfred Stock (Hg.) In Deutschland sind gegenwärtig, rechnet man die die kirchlichen Hochschulen hinzu, kaum drei Prozent der Studierenden an privaten Hochschulen immatrikuliert. Aber seit Anfang der 90er Jahre nimmt die Anzahl dieser Hochschulen dramatisch zu. Die privaten Hochschulen ziehen mehr und mehr die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Diesem zunehmenden Interesse auf Seiten der Öffentlichkeit steht bislang in Deutschland ein geringes Interesse auf Seiten der Wissenschaft gegenüber. Mit dem Themenheft "Private Hochschulen - Private Higher Education" werden in Deutschland erstmalig im Überblick Ergebnisse der internationalen Forschung zu privaten Hochschulen publiziert. Das Heft enthält deutsch- und englischsprachige Texte zur Entwicklung privater Hochschulen in den USA, in Lateinamerika, in Ost- und Westeuropa sowie zu weltweiten Entwicklungstrends in diesem Bereich des Hochschulwesens. |

Diese Ausgabe der Zeitschrift "die hochschule" bietet eine vielfältige Palette von grundlegenden Aufsätzen zur Hochschulforschung, Hochschulreform und Hochschulpolitik. |
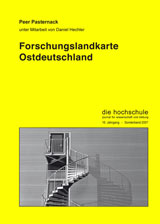
Peer Pasternack Bei der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern schnitten die ostdeutschen Universitäten in beiden Bewerbungsrunden unterdurchschnittlich ab. Ist damit alles wesentliche über die Wissenschaft in den östlichen Bundesländern gesagt, und muss die dort betriebene Forschung eher als Bestandteil der allgemeinen Problemsituation Ost statt als Teil einer Problemlösungskonstellation betrachtet werden? Um diese Fragen zu beantworten, wird ein realistisches Bild der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft benötigt. Dieses wird hier vorgelegt. Die Forschungslandkarte Ostdeutschland dokumentiert und beschreibt die Forschungslandschaft gegliedert nach ihren verschiedenen Sektoren: Forschung an Hochschulen – Universitätsforschung und Fachhochschulforschung –, öffentlich finanzierte außeruniversitäre Forschung – gemeinschaftsfinanzierte Institute, Landesinstitute und Ressortforschung – sowie Industrieforschung. Die Sektoren werden mit ihren Institutionen, fachlichen Profilen, der finanziellen und personellen Ausstattung sowie ihren Leistungsdaten dargestellt. Im Ergebnis werden Stärken und Schwächen herausgearbeitet sowie regionale Forschungsschwerpunkte und Wissenschaftscluster identifiziert. |

Martin Winter (Hg.) Vor mittlerweile 10 Jahren begann der Bologna-Prozess mit dem Treffen von vier Bildungsministern an der Sorbonne-Universität in Paris. Seine Erfolgsgeschichte ist erstaunlich: Es gibt mittlerweile kaum ein europäisches Land, das sich der Studienstrukturreform verweigert; auch in Deutschland stellen fast alle Hochschulen auf die gestuften und modularisierten Studiengänge um. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Wie ist der Bologna-Prozess in die europäische Bildungspolitik einzuordnen? Wer sind die beteiligten Akteure auf den europäischen Konferenzen und welchen Einfluss haben sie? Welche Auswirkungen hat die Studienreform auf die Studierenden? Diesen und anderen Fragen widmet sich der Themenschwerpunkt in diesem Heft der Zeitschrift "die hochschule". |

Reinhard Kreckel / Peer Pasternack (Hg.) Seit 1996/97 besteht das Institut für Hochschulforschung an der Universität Halle-Wittenberg. Die vom Institut herausgegebene Zeitschrift "die hochschule" resümiert dieses erste Jahrzehnt. In den Beiträgen der Mitarbeiter/innen des Instituts werden die einzelnen Themengebiete vorgestellt, die Projektlinien nachgezeichnet und die jeweiligen Forschungsergebnisse zusammengefasst. |
|
Karsten König (Hg.) Zehn Jahre nach dem ersten Hochschulpakt und den ersten Zielvereinbarungen zwischen Hochschulen und Landesregierungen veröffentlicht "die hochschule" eine Zwischenbilanz zur Kontraktsteuerung. Im Themenschwerpunkt dieses Heftes wird der Stand der Forschung zu vertragsförmigen Vereinbarungen sowohl zwischen Landesregierung und Hochschulen als auch organisationsintern zwischen Hochschul- und Fakultätsleitungen zusammengefasst und kritisch reflektiert. |

Georg Krücken (Hg.) Das Heft 1/2006 beschäftigt sich mit zentralen Aspekten des Wandels der universitären Forschung. Gerade in den letzten Jahren sind verstärkt Forderungen nach einem grundlegenden Wandel der an Universitäten betriebenen Forschung laut geworden. An die Stelle des traditionellen Forschungsideals der zweckfreien Grundlagenforschung tritt die Erwartung, dass sich die Forschung frühzeitig mit Anwendungskontexten vernetzt und stärker an gesellschaftlichen Problemen ausrichtet. Begleitet wird dies von einer erhöhten Rechenschaftspflicht, die in regelmäßigen Evaluationen zum Ausdruck kommt, sowie einer Zunahme des wissenschaftlichen Wettbewerbs um Ressourcen und Aufmerksamkeit. Im Themenschwerpunkt werden unterschiedliche Facetten dieser Entwicklung näher beleuchtet. Dabei geht es im Wesentlichen um zwei Fragen: Ändert sich die universitäre Forschung tatsächlich so, wie zuvor beschrieben, oder sind nicht vielmehr eher symbolische Anpassungen, Trägheiten und 'business as usual' zu beobachten? Welche Folgen hat der Wandel für die Hochschulen und die an ihnen betriebene Forschung und wie sind die Folgen zu bewerten? Während die Antworten auf die erste Frage unterschiedlich ausfallen, besteht Konsens, dass man stärker als bislang die nicht-intendierten und problematischen Folgen der Veränderungen in den Blick nehmen muss. |
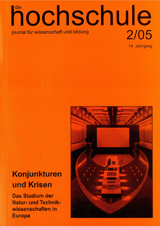
Konjunkturen und Krisen In diesem Heft geht es im Schwerpunkt um das Studium der Natur- und Technikwissenschaften in Europa. Dieser Themenschwerpunkt ist eine gemeinsame Produktion mit drei weiteren europäischen Zeitschriften, dem "European Journal of Education", der "Politiques d'éducation et de formation" und dem "European Journal of Vocational Training". Diese Zeitschriften und ihre herausgebenden Institute sind Bestandteil von REDCOM (Réseau européen de dissémination en éducation comparée), dem 2004 gegründeten Europäischen Netzwerk für die Verbreitung vergleichender Bildungsforschung. Jean Gordon stellt einleitend REDCOM vor, während Bernard Convert in die Konjunkturen und Krisen des natur- und technikwissenschaftlichen Studiums in Europa einführt. Drei Fallstudien befassen sich sodann mit Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Weitere Beiträge des Heftes sind u.a. von John W. Meyer und Evan Schofer über die globale Expansion der Universitäten im 20. Jahrhundert und von Hans R. Friedrich über den Bologna-Prozess nach Bergen. |
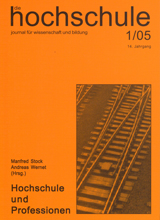
Manfred Stock / Andreas Wernert (Hg.) Das Heft 1/2005 will eine professionalisierungstheoretische Diskussion im Kontext der Hochschulforschung anstoßen. Bislang haben professionssoziologische Analysen kaum Eingang in die Debatte um Hochschulen und ihre Reformen gefunden. Dies scheint aber aus zweierlei Gründen notwendig. Zum einen bedarf es dringend einer Kritik des hochschulpolitischen Professionalisierungsjargons. Denn im Kontext der eingeleiteten Strukturveränderungen im deutschen Hochschulwesen scheint die Berufung auf den Professionalisierungsbegriff einem Legitimationsinteresse geschuldet. Die klassischen soziologischen Modelle einer professionalisierten Berufspraxis werden dabei geradezu konterkariert: die geplanten Reformen, die regelmäßig als Professionalisierung der Hochschulen gepriesen werden, sind auf alles andere gerichtet als auf die Stärkung einer professionsethisch gebundenen, eigenlogischen, beruflich autonomen Handlungssphäre von Forschung und Lehre. Damit zusammenhängend haben - zum anderen - professionstheoretische und professionssoziologische Analysen bislang in die Hochschulforschung kaum Eingang gefunden. Hier fehlt es weitgehend an Forschungsbeiträgen, die dazu in der Lage wären, Prozesse der Professionalisierung und der Deprofessionalisierung empirisch auszuweisen. Der Themenschwerpunkt des Heftes enthält einerseits Beiträge, die sich mit Problemen der Entwicklung professioneller Berufskulturen angesichts der aktuellen hochschulpolitischen Umstrukturierungen beschäftigen. Andererseits wurden Beiträge aufgenommen, die in einer eher grundlagentheoretischen und historischen Perspektive das Verhältnis von Hochschule und Professionen analysieren. |
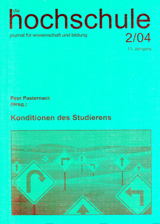
Peer Pasternack (Hg.) Der Schwerpunkt dieses Hefts lenkt den Blick auf die Bedingungen des Studierens. Mit Beiträgen über den Hochschulzugang, die Studierenden, die Bedingungen des Lernens und die Hochschulfinanzierung werden einige Widersprüche der aktuellen hochschulpolitischen Debatte beleuchtet. Um das Studium und die Studierenden herum entfaltet sich heutzutage ein unentwegter Hochschulreformbetrieb voller neuer und gelegentlich älterer Ideen. Eigentümlich sind dabei bisweilen die Verknüpfungen von Ideen. So bringt etwa der in Deutschland anzutreffende Versuch, hochschulpolitisch sowohl den Bologna-Prozess fördern wie zugleich auch die Ressourcen auf Elitebildung konzentrieren zu wollen, Widersprüche mit sich, die schlecht unaufgelöst im Raum stehen bleiben können. Oder: Erstaunen hervorrufen muss die mit der Studiengebühren-Erörterung verknüpfte Erwartung, auf dem Wege individueller Beteiligungen an den Studienkosten ließen sich die Finanzprobleme der deutschen Hochschulen bewältigen - das Missverhältnis der benötigten und der ggf. zu generierenden Geldbeträge ist hier doch sehr überdeutlich. Die Beiträge des Themenschwerpunkts dieses Heftes liefern Materialien zur begründeten Auflösung unangemessener Ideenverknüpfungen in der aktuellen hochschulpolitischen Debatte. |

Martin Winter (Hg.) Bislang eine erstaunlich vernachlässigte Fragestellung der Hochschulforschung: Wie sind Hochschulen intern organisiert und wie funktioniert ihre Binnensteuerung? Wenn Fragen der Hochschulorganisation diskutiert wurden, dann in Hinblick auf Leitungsstrukturen und Kontraktmanagement; andere formale und informelle Aspekte der Hochschulorganisation blieben dagegen weitgehend unterbelichtet. In dem Themenschwerpunkt dieses Hefts liegt der Fokus auf dieser vernachlässigten Binnenperspektive der Hochschule als Organisation. Im Grunde handeln alle Beiträge des Themenhefts von den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, Hochschulen von innen heraus zu steuern. In drei Abschnitte können die Aufsätze im Themenschwerpunkt eingeteilt werden: Erstens wird das Steuerungsproblem aus der organisationstheoretischen Perspektive diskutiert. Zweitens beschäftigen sich einige AutorInnen mit speziellen Problemen der Organisationsgestaltung, wie dem Zusammenhang von Hochschulmanagement, Budgetierung und Organisationsstrukturen. Drittens werden Geschichte, Gegenwart und Reformbeispiele der Fakultätsgliederung und Fachbereichsschneidung vorgestellt. |

Anke Burkhardt / Uta Schlegel (Hg.) Gleichstellungspolitik ist kein neues Thema im Hochschulbereich; neu sind hingegen die Strategien, die zum Ziel der Gleichstellung führen sollen. Etikettiert werden diese Strategien mit modern und professionell klingenden Begriffen, die allerdings dem interessierten Publikum weitgehend unbekannt sind. Mag das Konzept "Gender Mainstreaming" mittlerweile einigermaßen geläufig sein, so stoßen Begriffskonstruktionen wie "Managing Diversity", "Gender Mentoring" oder gar "Gender Impact Assessment" zumeist auf Unkenntnis. Hier tut Aufklärung not. Die Vermittlung von gleichstellungspolitischem Reformvokabular ist aber nur das eine, das andere ist die Analyse der Chancen, Risiken und Nebenwirkungen dieser neuen Strategien der Gleichstellungspolitik. Beides hat sich dieses Heft zur Aufgabe gemacht. |
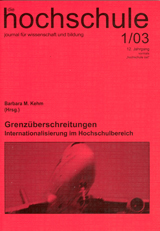
Barbara M. Kehm (Hg.) Internationalisierung ist an sich kein neues Thema im Politikfeld Hochschule, aber die Entwicklungen der letzten Zeit, Stichwörter hierzu sind GATS (General Agreement on Trade in Services), und der fortschreitende sog. Bologna-Prozess, der insbesondere eine "Harmonisierung" der Studiengänge in Europa forciert, drücken das Thema weiterhin nach ganz oben auf die hochschulpolitische Tagesordnung. Jenseits der - zwangsläufig recht oberflächlichen - tagespolitischen Diskussion werden in den Beiträgen dieses Heftes zum Themenschwerpunkt "Grenzüberschreitungen - Internationalisierung im Hochschulbereich" verschiedene Probleme der Europäisierung, Internationalisierung und Globalisierung aus der Perspektive der Hochschulforschung wie auch der Hochschulpraxis eingehend erörtert. |

Das Heft bietet eine vielfältige Palette von grundlegenden Aufsätzen zur Hochschulforschung, Hochschulreform und Hochschulpolitik. Den Anfang macht Reinhard Kreckel, der mit seinen 12 Thesen zur Universitätsreform das tatsächliche und zukünftige Verhältnis von Universitäten und Fachhochschulen genauer beleuchtet. Zu diesen 12 Thesen nehmen Detlef Müller-Böling und Johanna Wanka kritisch Stellung. Neben weiteren Beträgen zu den Grundsatzdiskussionen um Hochschulen, Qualität und Organisation gibt es Aufsätze zu Aspekten der DDR-Vergangenheit sowie einen Länderbericht zur Lage und zur Entwicklung der Hochschulen in Belarus. |

Peer Pasternack / Martin Winter (Hg.) Das erste Ausgabe der Zeitschrift "die hochschule. journal für wissenschaft und bildung" hat den Themenschwerpunkt "Szenarien der Hochschulentwicklung". Darin beschäftigen sich namhafte AutorInnen mit der Frage, was aus den Hochschulen der Republik in Zukunft werden wird und was aus ihnen werden soll. |