Vier Anläufe: Soziologie an der Universität Halle-Wittenberg. Bausteine zur lokalen Biografie des Fachs vom Ende des 19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts

Die Soziologie an der Universität Halle-Wittenberg hatte eine bewegte Geschichte. Insgesamt benötigte sie vier Anläufe zu ihrer Institutionalisierung, angefangen bei der Einrichtung des ersten Lehrstuhls für Soziologie 1930 (bis 1933) und des ersten Instituts für Soziologie 1947 (bis 1949) über den Wissenschaftsbereich Soziologie an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (1965-1990) bis hin zur Neugründung des heutigen Instituts… mehr
Soziologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: Dokumentation zum Zeitraum 1945 – 1991
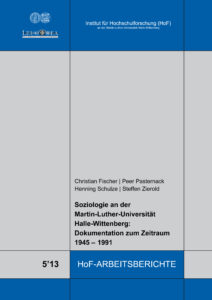
Die Dokumentation stellt einen Anhang zur Buchpublikation Peer Pasternack/Reinhold Sackmann (Hg.): Vier Anläufe: Soziologie an der Universität Halle-Wittenberg. Bausteine zur lokalen Biografie des Fachs vom Ende des 19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts, Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2013 dar. Dokumentiert werden hier Rechercheergebnisse zur Soziologie an der Martin-Luther-Universität seit dem Kriegsende bis zum Umbruch… mehr
HoF-Lieferungen. Die Buchpublikationen des Instituts für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF)
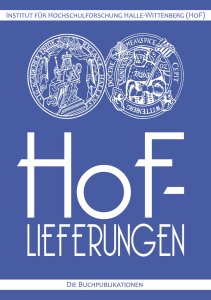
Die Forschungsarbeit des Instituts für Hochschulforschung spiegelt sich vor allem in den daraus entstehenden Publikationen wider. Unter diesen wiederum ragen die Monografien, Sammelbände, Themenhefte der Institutszeitschrift „die hochschule“ und Online-Dokumentationen heraus: Sie sind die wesentlichen geronnenen Ergebnisse der häufig mehrjährigen Projekte. Die soeben erschienene Broschüre „HoF-Lieferungen: Die Buchpublikationen“ stellt die seit 1997 erschienenen Veröffentlichungen, inhaltlich… mehr
Lebensqualität entwickeln in schrumpfenden Regionen. Die Demographie-Expertisen der Wissenschaft in Sachsen-Anhalt

Eines der wichtigsten endogenen Potenziale Sachsen-Anhalts stellt die ansässige Wissenschaft dar. Das gilt nicht nur hinsichtlich der Entwicklung von regionalen Innovationsstrukturen (FuE), sondern auch im Blick auf die Expertise zum demografischen Wandel und zur Raumentwicklung. Diese Bedeutung ergibt sich aus einem einfachen Umstand: Von außen wird die notwendige Expertise nicht im erforderlichen Umfang zu bekommen… mehr
BeMission: Die Third Mission in der Leistungsbewertung von Hochschulen

Das HoF führt zwischen 2013 und 2016 ein Forschungsprojekt durch, das im Rahmen des BMBF-Förderprogramms „Leistungsbewertung in der Wissenschaft“ gefördert wird. Leistungsbewertung in der Wissenschaft ist nichts prinzipiell Neues. Wettbewerb um individuelle fachliche Reputation und institutionelles Renommee kennzeichnet das akademische System seit alters her. Dennoch hat die Leistungsbewertung in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung… mehr
EU-Strukturfondsfinanzierung für wissenschaftliche Einrichtungen
Die EU-Strukturförderung soll von 2014 an auf die Ziele der EU-Strategie „Europa 2020“ ausgerichtet werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie wissenschaftliche Einrichtungen, insbesondere Hochschulen, zu intelligentem, nachhaltigem und inklusivem Wachstum in ihrer Sitzregion beitragen können. Welches sind Handlungsfelder, auf denen wissenschaftliche Einrichtungen hier aktiv werden können? Wie können wissenschaftliche Einrichtungen erfolgreich in… mehr
Referenzraum Sachsen-Anhalt
Als Landeseinrichtung Sachsen-Anhalts widmet das Institut für Hochschulforschung seit seiner Gründung 1996 seinem Sitzland eine spezielle Aufmerksamkeit. Untersucht wurden und werden Themen aus dem gesamten Spektrum der Hochschulforschung und angrenzende Themen. Das Institut macht damit seine überregionale Expertise für die Hochschulentwicklung seines Sitzlandes nutzbar. Umgekehrt mobilisiert HoF mit diesen Arbeiten Sachsen-Anhalt als Fallbeispiel in Untersuchungen,… mehr
Rebellion im Plattenbau. Die Offene Arbeit in Halle-Neustadt 1977–1983
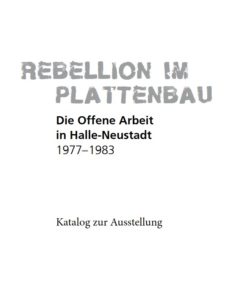
Die sozialistische Chemiearbeiterstadt Halle-Neustadt war ein Prestige–projekt der DDR-Staatsführung. Ein bisher kaum bekanntes Kapitel die-ses heutigen Stadtteils ist die „Offene Arbeit“ (OA) in der evangelischen Kirchengemeinde Halle-Neustadt von 1977 bis 1983. Es ist im Stadtgedächtnis faktisch nicht vorhanden. Daran sollen die Ausstellung, die erstmals im Juni/Juli 2013 im Evangelischen Gemeindezentrum Halle-Neustadt (Passendorf ) gezeigt wird,… mehr
Wissensgeschichte planstädtischer Agglomerationen: Das Beispiel Halle-Neustadt
1964 gegründet, weist Halle-Neustadt eine sequenzielle Doppelgeschichte auf: 25 Jahre DDR-Stadt und fast 25 Jahre Stadt(teil) im neuvereinten Deutschland. Im Zuge dessen wurde Halle-Neustadt zum doppelten Prototyp: erst der geplant expandierenden sozialistischen Stadt in der DDR und hernach der ungeplant schrumpfenden Stadt in Ostdeutschland. Beides war bzw. ist verbunden mit zwei verschiedenen symbolischen Stadtkonstruktionen, die… mehr
Gleichstellung von Frauen und Männern an Hochschulen in Sachsen-Anhalt
In dem Projekt wird im Rahmen der Kooperation zwischen WZW Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt und HoF eine Bestandsaufnahme der Gleichstellungssituation und der Gleichstellungsaktivitäten an den Hochschulen Sachsen-Anhalts unternommen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Norm der Geschlechtergerechtigkeit in besonders intensiv vom demografischen Wandel betroffenen Regionen eine Ressource darstellt, die zur demografischen Stabilisierung beitragen kann. Zum anderen findet… mehr
Zweckfrei nützlich: wie die Geistes- und Sozialwissenschaften regional wirksam werden. Fallstudie Sachsen-Anhalt
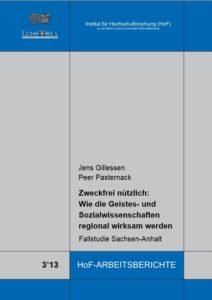
Die Frage nach regionalen Effekten der Geistes- und Sozialwissenschaften erscheint der Mehrheit ihrer Vertreter/innen suspekt. In der Tat: In kognitiver Hinsicht gibt es keine regionalen Geistes- und Sozialwissenschaften. Doch da es regionale Gebietskörperschaften sind, welche die Grundfinanzierung der Hochschulen tragen, sollte man auf die Frage nach regionalen Wirkungen vorbereitet sein. Um das etwas sperrige Thema… mehr
Eingänge und Ausgänge. Die Schnittstellen der Hochschulbildung in Sachsen-Anhalt
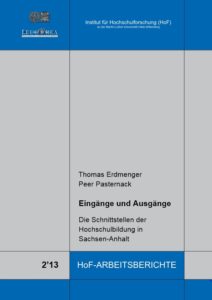
Mit der Eingangs- und der Ausgangsschnittstelle des Studiums sind die Hochschulen in die individuellen Biografien geschaltet und an das Schulsystem und das Beschäftigungssystem gekoppelt. Die Eingangsschnittstelle baut auf den Vorleistungen des Schulsystems auf, das die bildungsbiografischen Eingangsvoraussetzungen der Studienanfänger bestimmt. Das Schulsystem wiederum ist in hohem Maße von Bedingungen abhängig, die es nicht beeinflussen kann…. mehr
Regionale Relevanz der Sozial- und Geisteswissenschaften
Regionale Entwicklungsbeiträge der Sozial- und Geisteswissenschaften (SGW) lassen sich zwar nur schwer quantifizieren. Daraus folgt jedoch nicht, dass sie unbedeutsam wären. Das Projekt zielt darauf ab, sie sichtbar zu machen. Dazu wird zweierlei unternommen: (1) In einer sozialwissenschaftlichen Außenperspektive auf die SGW werden deren gegenwärtige Ausstattung und Strukturen, spezifische Wertschöpfungsbeiträge und demografische Effekte in Augenschein… mehr
Studienerfolg und -abbruch in Sachsen-Anhalt
Das Kooperationsprojekt von HoF und WZW Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt ermittelte überregional Daten und Ursachen für Studienerfolg und -abbrüche und prüfte sie für die konkrete Situation in Sachsen-Anhalt. Da sich aus den amtlichen Daten keine individuellen Studienverläufe rekonstruieren lassen und zudem die Umstellungssituation auf das Bachelor-Master-System zu berücksichtigen ist, war dabei die Entwicklung neuer Berechnungsmethoden notwendig, um die… mehr
Studieren mit und ohne Abschluss. Studienerfolg und Studienabbruch in Sachsen-Anhalt
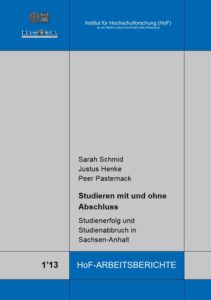
Der Report ermittelt erstmals für Sachsen-Anhalt hochschul- und fächergruppenspezifische Studienerfolgsquoten. Hierfür wird ein entsprechendes Berechnungsmodell entwickelt und angewandt. Daneben werden studienabbruchrelevante Problemlagen der Studierenden sowie abbruchgefährdete Studieren-dengruppen identifiziert und die Ursachen der Abbrüche an den Hochschulen eingegrenzt. Deutlich wird: Die Hochschulen Sachsen-Anhalts vermochten es, einen Zuwachs an Studierenden innerhalb von zehn Jahren um fast 50… mehr
Die An-Institutslandschaft in Sachsen-Anhalt

An-Institute als organisatorisch sowie rechtlich eigenständige wissenschaftliche Einrichtungen, die einer Hochschule assoziiert sind, wurden (und werden) seit den 1980er Jahren deutschlandweit eingerichtet. Ihre Leistungsangebote sollen ergänzend bzw. komplementär zur jeweiligen Hochschule sein, also nicht in Konkurrenz zu ihrer Hochschule stehen. Gegenstand systematischer Erkundung waren sie bislang kaum. Im Rahmen einer Studie wurden sie am Fallbeispiel… mehr
Hochschul- und Wissensgeschichte in zeithistorischer Perspektive. 15 Jahre zeitgeschichtliche Forschung am Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg
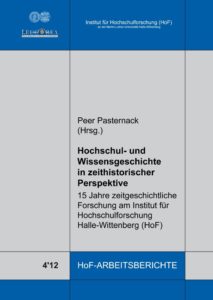
Das Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) befasst sich im Hauptgeschäft vorrangig mit gegenwartsbezogenen Fragestellungen der Hochschulentwicklung. Daneben hat sich über die Jahre hin ein eigenständiger Forschungsstrang zur Zeitgeschichte von Hochschule, Wissenschaft und Bildung etabliert: 42 Projekte sind in diesem Rahmen innerhalb der letzten 15 Jahre realisiert worden. Damit ist HoF die einzige unter den deutschen… mehr
Die An-Institutslandschaft in Sachsen-Anhalt
An-Institute als organisatorisch sowie rechtlich eigenständige wissenschaftliche Einrichtungen, die einer Hochschule assoziiert sind, wurden (und werden) seit den 1980er Jahren deutschlandweit eingerichtet. Ihre Leistungsangebote sollen ergänzend bzw. komplementär zur jeweiligen Hochschule sein, also nicht in Konkurrenz zu ihrer Hochschule stehen. Gegenstand systematischer Erkundung waren sie bislang kaum. Im Rahmen einer Studie wurden sie am Fallbeispiel… mehr
Soziologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1945-1990
Von 1947 und 1949 hatte es an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bereits ein Institut für Soziologie gegeben, doch eine eigentliche Institutionalisierung des Faches gelang erst 1965 mit der (1964 beschlossenen) Gründung einer eigenen Forschungsgruppe, dann „Wissenschaftsbereich marxistisch-leninistische Soziologie“ an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Dessen inhaltliche Schwerpunkte lagen in der Arbeits- und Industriesoziologie. 1976 startete ein eigenständiger Diplomstudiengang,… mehr
Demographischer Wandel als Querschnittsaufgabe. Fallstudien der Expertenplattform „Demographischer Wandel“ beim Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt

Seit 2009 arbeitet am WZW Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt Wittenberg die Expertenplattform Demographischer Wandel. Sie vereint dreißig Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die an Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes 17 Forschungsprojekte zum Thema bearbeiten. Dabei geht es u.a. um nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturanpassung, regionale Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Bildungs- und Qualifizierungsstrategien sowie familienfreundliche und alternssensible Wohn- und Lebensbedingungen. Die Mitglieder… mehr