Wer lehrt warum? Strukturen und Akteure der akademischen Lehre an deutschen Hochschulen
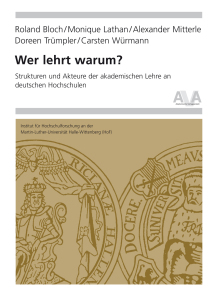
Wer lehrt eigentlich genau an deutschen Hochschulen – Professor/innen, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, Lehrbeauftragte? Und warum tun sie das? Um diese Fragen zu beantworten, haben die Autor/innen die Lehre und die Lehrenden eines Semesters an vier Universitäten und vier Fachhochschulen erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Konzentration auf die Professorenschaft in der Reformdiskussion nicht den Realitäten an… mehr
Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013
Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (2013): Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013. Statistische Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland. W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld. 360 Seiten. ISBN: 978-3-7639-5082-9 Aufgrund einer Terminverschiebung bei der Vorstellung des Berichts im BMBF kann dieser erst ab Mitte April veröffentlicht werden. Wir bitten um Verständnis. Download: Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013 Download:… mehr
Entwicklungen im deutschen Studiensystem. Analysen zu Studienangebot, Studienplatzvergabe, Studienwerbung und Studienkapazität
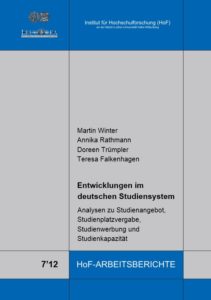
Die Organisations-und Steuerungsreformen der letzten Jahre in Verbindung mit dem demografisch bedingten Rückgang der Abiturientenzahlen lassen eine zunehmende ‚Verwettbewerblichung’im Hochschulwesen erwarten. Aufgrund dieser Reformen verfügen die Hochschulen über mehr Einfluss auf ihre eigene Entwicklung und strategische Ausrichtung. Mit der sogenannten Organisationswerdung der Hochschulen und der demografischen Entwicklung wird die Wettbewerbslogik auch auf dem Gebiet von… mehr
Analysen zu Studienangebot, Studienplatzvergabe, Studienwerbung und Studienkapazität (2011-2012)
Die dem Projekt zugrunde liegende These ist, dass die Kombination von Bologna-Studienreform, institutionellen Reformen an den Hochschulen und einem demografisch bedingten, regional unterschiedlich starken Rückgang der potenziellen Studienanfänger das Studiensystem mittel- und langfristig stärker wettbewerblich ausrichten wird. Hinweise hierfür können sein: Veränderungen des Studienangebots, Veränderungen in den Vergabe-, Zulassungs- und Auswahlverfahren sowie die Einführung bzw…. mehr
Entwicklung der universitären Personalstruktur im Kontext der Föderalismusreform
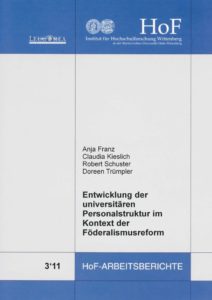
Infolge der Föderalismusreform kam es zur Aufhebung bundesweiter gesetzlicher Grundlagen für eine einheitliche Personalstruktur. Die vergleichende Analyse zeigt, dass die Landeshochschulgesetze trotz gestärkter Länderkompetenzen große Übereinstimmungen aufweisen. Auch statistische Analysen ergaben, dass es nach 2006 zu keiner entscheidenden Zäsur kam. Aktuelle Stellenausschreibungen betonen verstärkt die Einheit von Forschung und Lehre. Die Föderalismusreform eröffnete den einzelnen… mehr
Hochschulen nach der Föderalismusreform
Zwischen den Hochschulsystemen der deutschen Bundesländer bestehen traditionell deutliche Unterschiede hinsichtlich des Finanzierungsinputs und des Forschungsoutputs. Die Föderalismusreform 2006 hatte den Anspruch erhoben, wettbewerbsföderalistische Aspekte im Hochschulwesen zu stärken – und damit sowohl den herkömmlichen kooperativen Föderalismus als auch die aktive Beteiligung des Bundes an der Hochschulentwicklung in den Hintergrund treten zu lassen. Im Projekt… mehr
Wer lehrt was warum? Die Organisation der akademischen Lehre an deutschen Universitäten: Bedingungen, Strategien, Effekte
Unter der Leitfrage „Wer lehrt was warum?“ werden die Bedingungen, Strategien und Effekte der Organisation der akademischen Lehre an deutschen Hochschulen analysiert. Nachdem sich das Vorgängerprojekt unter der Fragestellung „Wer lehrt was unter welchen Bedingungen?“ auf die tatsächlich erbrachte Lehre an Hochschulen und die Lehrverteilung innerhalb und zwischen den Personalgruppen konzentriert hatte, geht es nun… mehr
Studium und Studienreform im Vergleich der Bundesländer
Zehn Jahre nach der Bologna-Erklärung der europäischen Bildungsminister zur Harmonisierung der europäischen Studienstrukturen wird eine Zwischenbilanz dieses Reformprozesses gezogen. Im ersten großen Abschnitt geht es um Zieldivergenzen, innere Widersprüche, konträre Trends und Dilemmata des Bologna-Prozesses. In den darauf folgenden Abschnitten werden die vielfältigen Chancen, Risiken und Nebenwirkungen der Studienstrukturreform in Deutschland untersucht.