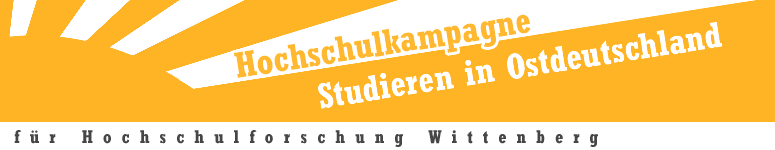Prognosen der Kultusministerkonferenz KMK
Kultusministerkonferenz 2005: Prognose der Studienanfänger, Studierenden und Hochschulabsolventen bis 2020. Dokumentation Nr. 176
Download: http://www.kmk.org/statistik/hochschule/statistische-veroeffentlichungen/prognose-der-studienanfaenger-studierenden-und-hochschulabsolventen-bis-2020.html 
Kultusministerkonferenz 2007: Die Mobilität der Studienanfänger und Studierenden in Deutschland von 1980 bis 2005. Dokumentation Nr. 183
Download: http://www.kmk.org/statistik/hochschule/statistische-veroeffentlichungen/die-mobilitaet-der-studienanfaenger-und-studierenden-in-deutschland.html 
Kultusministerkonferenz 2007: Vorausberechnung der Schüler- und Absolventenzahlen 2005 bis 2020. Beschluss der KMK vom 16.11.2006. Dokumentation Nr. 182
Download: http://www.kmk.org/statistik/schule/statistiken/vorausberechnung-der-schueler-und-absolventenzahlen.html 
Kultusministerkonferenz 2009: Vorausberechnung der Studienanfängerzahlen 2009 – 2020. Zwischenstand
Download: http://www.kmk.org/statistik/hochschule/statistische-veroeffentlichungen/prognose-der-studienanfaenger-studierenden-und-hochschulabsolventen-bis-2020.html 
Zahlen vom Statistischen Bundesamt
Neuer Höchststand bei Studienanfängerquote. Pressemitteilung Nr. 457 vom 01.12.2008
Nach ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) haben im Studienjahr 2008 rund 385 500 Erstsemester ein Studium in Deutschland aufgenommen. Die Studienanfängerquote – das ist der Anteil Studienanfängerinnen und -anfänger an der gleichaltrigen Bevölkerung – liegt für das Studienjahr 2008 bei 39%. Sie erreicht damit einen neuen Höchststand. [mehr]
Nach ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) haben im Studienjahr 2008 rund 385 500 Erstsemester ein Studium in Deutschland aufgenommen. Die Studienanfängerquote – das ist der Anteil Studienanfängerinnen und -anfänger an der gleichaltrigen Bevölkerung – liegt für das Studienjahr 2008 bei 39%. Sie erreicht damit einen neuen Höchststand. Das bildungspolitische Ziel, 40% eines Altersjahrgangs für ein Hochschulstudium zu gewinnen, wird also beinahe realisiert.
Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Erstimmatrikulierten um 7%. An den Universitäten betrug die Zunahme 3%, an den Fachhochschulen sogar knapp 13%. In fast allen Bundesländern ist eine deutliche Zunahme der Zahl der Studienanfängerinnen und ‑anfänger im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Die höchsten Steigerungen meldeten das Saarland (15%), Brandenburg und Hessen (jeweils 14%) sowie Hamburg (12%). Lediglich in Sachsen (– 2%) und Bremen (– 0,2%) ist eine rückläufige Tendenz erkennbar.
Für vier ausgewählte technisch orientierte Studienbereiche liegen erste vorläufige Informationen über die Studierenden vor, die 2008 ein entsprechendes Fachstudium aufnahmen. Rund 41 600 Studierende begannen 2008 mit dem Studium im Bereich Maschinenbau/Verfahrenstechnik (+ 11%). 32 100 schrieben sich erstmalig im Studienbereich Informatik ein (+ 4%), 17 400 in der Elektrotechnik (+ 4%) und 9 900 im Bereich Bauingenieurwesen (+ 11%).
Im gerade begonnenen Wintersemester 2008/2009 sind an den Hochschulen in Deutschland insgesamt 2,01 Millionen Studierende eingeschrieben. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von knapp 4%. Damit wird erstmals seit dem Wintersemester 2003/2004 wieder die Zwei-Millionen-Grenze überschritten. Der Anteil der Studentinnen liegt unverändert bei 48%. 1,41 Millionen (70%) Frauen und Männer studieren an Universitäten oder vergleichbaren Hochschulen, 603 700 (30%) an Fach- oder Verwaltungsfachhochschulen (Text übernommen).
Link: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,463318,00.html 
Studien des Centrums für Hochschulentwicklung CHE Gütersloh
Buch, Florian; Hener, Yorck; von Stuckrad, Thimo 2006: Prognose der Studienkapazitätsüberschüsse und -defizite in den Bundesländern bis zum Jahr 2020, CHE-Arbeitspapier Nr. 77
In seiner Prognose hat das CHE die Schulabgängerzahlen, wie sie von der Kultusministerkonferenz bis zum Jahr 2020 vorausberechnet worden sind, mit den länderspezifischen Übergangsquoten ins Studium und der Studierendenmobilität innerhalb Deutschlands verknüpft. Damit können Aussagen über die Verteilung der Studienanfänger auf die einzelnen Bundesländer gemacht werden. [mehr]
In seiner Prognose hat das CHE die Schulabgängerzahlen, wie sie von der Kultusministerkonferenz bis zum Jahr 2020 vorausberechnet worden sind, mit den länderspezifischen Übergangsquoten ins Studium und der Studierendenmobilität innerhalb Deutschlands verknüpft. Damit können Aussagen über die Verteilung der Studienanfänger auf die einzelnen Bundesländer gemacht werden. In einem zweiten Schritt wurden die prognostizierten Studienanfängerzahlen von der durchschnittlichen Studienanfängerzahl der Jahre 2000 bis 2004 subtrahiert, um die Entwicklung relativ zu einem Ist-Stand zu erfassen. So kann die verfügbare bzw. erforderliche Studienkapazität abgebildet werden. Es wird eine Gruppe der Bundesländer mit Studienkapazitätsüberschuss und eine Gruppe der Bundesländer mit Studienkapazitätsdefizit gegenübergestellt. Die Berechnung geht dabei von Studienanfängern, nicht von Studierenden aus. (HoF/Text übernommen)
Download: http://www.che.de/downloads/Prognose_Studienkapazitaet_AP77.pdf 
Berthold, Christian; Gabriel, Gösta; Meyer, Helga; von Stuckrad, Thimo 2007: Fächerspezifische Kostenstrukturen für Studienplätze nach Bundesländern. Materialien zum Studierendenhoch. CHE-Arbeitspapier Nr. 82
Dieses Arbeitspapier widmet sich den verschiedenen Aspekten, die berücksichtigt werden müssen, wenn man die Chance nutzen will, die sich aus dem Studierendenhoch ergibt. Zunächst muss leider festgestellt werden, dass aus einer höheren Zahl von hochschulberechtigten SchulabgängerInnen noch längst nicht auch mehr Studierende werden (wie die sinkenden Studienanfängerzahlen in den letzten beiden Jahren verdeutlichen). [mehr]
Dieses Arbeitspapier widmet sich den verschiedenen Aspekten, die berücksichtigt werden müssen, wenn man die Chance nutzen will, die sich aus dem Studierendenhoch ergibt. Zunächst muss leider festgestellt werden, dass aus einer höheren Zahl von hochschulberechtigten SchulabgängerInnen noch längst nicht auch mehr Studierende werden (wie die sinkenden Studienanfängerzahlen in den letzten beiden Jahren verdeutlichen). Wenn dies aber gelingen soll, dann muss neben einer Fülle von Faktoren, die die individuellen Entscheidungen von SchulabgängerInnen beeinflussen, vor allem die Kapazität an Studienangeboten ausgebaut werden. Dies kann auf der Landesebene und gesamtstaatlich nur gelingen, wenn mehrere übergreifende Fragestellungen berücksichtigt werden. Dazu liefert dieses Arbeitspapier Materialien und Hinweise in vier Dimensionen. Erstens verläuft die Entwicklung der Zahlen von potenziellen StudienanfängerInnen in den Ländern sehr heterogen. So gibt es einen dramatischen Unterschied zwischen den alten und neuen Bundesländern, in denen der demographische Wandel bereits jetzt durchschlägt. Darüber hinaus allerdings gibt es auch innerhalb der einzelnen Länder und Regionen deutliche Entwicklungsunterschiede, die für die Planungen der Länder und Hochschulen zum Umgang mit dem Studierendenhoch relevant sind. Zweitens arbeitet der Hochschulpakt mit durchschnittlichen Ausgaben. Das ist aus pragmatischen Gründen sicher angemessen, wirft aber die Frage auf, wie sich die Ausgabenstrukturen der einzelnen Länder zu dem herangezogenen Durchschnittswert verhalten. Denn die relativen Ausgaben der Hochschulen je Studierendem / je Studierender variieren zwischen den Bundesländern deutlich. Manche Länder geben also relativ mehr für ihre Studierenden aus und andere weniger als den jetzt im Hochschulpakt herangezogenen Durchschnittswert. Drittens kann diese Herausforderung nicht angemessen bewältigt werden, wenn allein "Studienplätze" betrachtet werden und nicht die Dimension der Fachlichkeiten berücksichtigt wird. Schließlich kann die gesamtstaatliche Verantwortung nicht nur gegenüber den jungen Menschen gelten, die mit einer Hochschulzugangsberechtigung jetzt vermehrt die Schulen verlassen, sondern sie muss daneben auch den Bedarf in Wirtschaft und Gesellschaft berücksichtigen. Dann aber werden die Ausgabenstrukturen und die erwartbaren Kosten der Länder für einen Ausbau der Studienkapazitäten berührt. Denn die Ausgaben weichen nicht nur signifikant zwischen den Bundesländern, sondern auch zwischen den einzelnen Fächergruppen innerhalb der Länder voneinander ab. Die Steuerung der Hochschulen in Deutschland hat bisher immer einen engen Zusammenhang zwischen Ressourceneinsatz und Qualität unterstellt. Mit Hilfe der Kapazitätsverordnung und der Curricularnormwerte waren die Betreuungsrelationen in den Fächern fest definiert. Die verschiedenen Ausgabenstrukturen in den Ländern zeigen, dass auch bezogen auf den einzelnen Studierenden bzw. die einzelne Studierende zum Teil erheblich Differenzen im Mitteleinsatz bestehen. So wie bisher gesteuert wurde - und wie der Hochschulpakt in seiner Grundlogik funktioniert - wäre zu erwarten, dass die Qualität dort geringer ist, wo weniger Geld eingebracht wird. Dies ist aber nicht zwingend; Kostenunterschiede können genauso Effizienzdifferenzen oder andere Faktoren abbilden. Zur Illustration dieses Aspektes wird hier viertens exemplarisch die Dimension der Qualität in den Blick genommen - und die Ausgabenstruktur in Sachsen, bezogen auf einzelne Fächergruppen, mit Ergebnissen des CHE-Hochschulrankings verknüpft. (HoF/Text übernommen)
Download: http://www.che.de/downloads/CHE_Kostenstrukturen-Studierendenhoch_AP82.pdf 
von Stuckrad, Thimo; Gabriel, Gösta Ingvar 2007: Die Zukunft vor den Toren - Aktualisierte Berechnungen zur Entwicklung der Studienanfängerzahlen bis 2020, Gütersloh, CHE-Arbeitspapier 100
Die vorliegende Studie stellt eine quantitative Prognose der Studiennachfrage an deutschen Hochschulen bis 2020 dar, differenziert nach Bundesländern und Jahren. Demnach steigt die Zahl der deutschen StudienanfängerInnen in den nächsten Jahren deutlich an, erreicht im Jahr 2013 einen Höhepunkt und bleibt auch über das Jahr 2020 hinaus auf hohem Niveau. [mehr]
Die vorliegende Studie stellt eine quantitative Prognose der Studiennachfrage an deutschen Hochschulen bis 2020 dar, differenziert nach Bundesländern und Jahren. Demnach steigt die Zahl der deutschen StudienanfängerInnen in den nächsten Jahren deutlich an, erreicht im Jahr 2013 einen Höhepunkt und bleibt auch über das Jahr 2020 hinaus auf hohem Niveau. Die Studie fußt methodisch auf der prognostizierten Entwicklung der Studienberechtigtenzahlen im gleichen Zeitraum. Diese Entwicklung beruht im Projektionszeitraum auf drei Determinanten: der demographischen Entwicklung, der Bildungsbeteiligung und bildungspolitischen Grundsatzentscheidungen. Gliederung: 1. Einleitung. - 2. Methodik. - 3. Ergebnisse (1. Studienkapazitätsüberschüsse und -defizite der Länder bis 2020. - 2. Modellrechnungen zu den Kosten des Nachfragehochs) (HoF/Text übernommen)
Download: http://www.che.de/downloads/CHE_Prognose_Studienanfaengerzahlen_AP100.pdf 
Studien des Instituts für Hochschulforschung HoF Wittenberg
Lischka, Irene unter Mitarbeit von Kreckel, Reinhard 2006: Zur künftigen Entwicklung der Studierendenzahlen in Sachsen-Anhalt. Prognosen und Handlungsoptionen. HoF-Arbeitsbericht 2/2006
Im Auftrag der Landesrektorenkonferenz von Sachsen-Anhalt wurde am Institut eine Expertise erstellt, die künftige Entwicklungen der Studienanfänger- und Studierendenzahlen in Sachsen-Anhalt berechnet, begründet und Handlungsoptionen zur Stabilisierung der Hochschullandschaft des Landes aufzeigt. [mehr]
Im Auftrag der Landesrektorenkonferenz von Sachsen-Anhalt wurde am Institut eine Expertise erstellt, die künftige Entwicklungen der Studienanfänger- und Studierendenzahlen in Sachsen-Anhalt berechnet, begründet und Handlungsoptionen zur Stabilisierung der Hochschullandschaft des Landes aufzeigt.
Ausgangspunkt dafür ist die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt, die ähnlich wie die in den anderen neuen Bundesländern durch einen starken Rückgang der Geburten- und damit der Schülerzahlen gekennzeichnet ist. Anhand unterschiedlicher Entwicklungsszenarien werden die Auswirkungen auf die Nachfrage nach Hochschulbildung modelliert. Grundlage dafür ist ein am Institut entwickeltes langzeitiges Prognosemodell für Länder und Regionen, mit dem sehr unterschiedliche soziale Entwicklungen modelliert und berechnet werden können. Für Sachsen-Anhalt wurde davon ausgehend insbesondere die Entwicklung der Studienberechtigtenquoten und Übergangsquoten ins Studium, der Bildungsmigration und des Studienberechtigtenaufkommens in anderen Bundesländern berücksichtigt. Aber auch die Einführung von Studiengebühren und Auswahlverfahren, der Übergang zu gestuften Studiengängen in Verbindung mit wissenschaftlicher Weiterbildung wurden hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Nachfrage nach Hochschulbildung hinterfragt. Im Ergebnis zeigen Modellrechnungen nach unterschiedlichen Szenarien mögliche Entwicklungen der Studienanfänger- und Studierendenzahlen in Sachsen-Anhalt und daraus resultierende Erfordernisse.
Anhand der vorliegenden Prognosemodelle können auch kurz-, mittel- und langzeitige Prognosen zu anderen Bundesländern bzw. ausgewählten Regionen erstellt werden. Das Institut nimmt entsprechende Aufträge entgegen.
(aus Pressemitteilung des HoF, im Internet: http://www.hof.uni-halle.de/index,id,76.html#253)
Download: http://www.hof.uni-halle.de/cms/download.php?id=76 
Lischka, Irene 2006: Entwicklung der Studierwilligkeit. 116 S. HoF-Arbeitsbericht 3/2006
Das sechste Mal in Folge hat HoF Wittenberg - das Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg - die Studierwilligkeit in den Klassenstufen 10 und 12/13 an Gymnasien der neuen Bundesländer, in Niedersachsen und Berlin untersucht. Im Unterschied zu den neunziger Jahren und auch abweichend von anderen Bundesländern ist das Interesse an einem Studium in den neuen Bundesländern weiter gestiegen. [mehr]
Das sechste Mal in Folge hat HoF Wittenberg - das Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg - die Studierwilligkeit in den Klassenstufen 10 und 12/13 an Gymnasien der neuen Bundesländer, in Niedersachsen und Berlin untersucht. Im Unterschied zu den neunziger Jahren und auch abweichend von anderen Bundesländern ist das Interesse an einem Studium in den neuen Bundesländern weiter gestiegen. Das gilt vor allem für die weiblichen Gymnasiasten und die aus hochschulfernen Regionen. Die angehenden Studienberechtigten setzen sich intensiver als in früheren Jahren mit der Studienentscheidung auseinander. Sie möchten häufiger als bislang an Universitäten studieren, streben aber vorwiegend noch traditionelle Studienabschlüsse an. Inwieweit sie ein Studium auch tatsächlich beginnen werden, wird auch von den Studiengebühren abhängen. Das dürfte auch eine Ursache des gestiegenen Zuspruchs für die Hochschulen in den neuen Bundesländern sein, die bisher von Studiengebühren noch weitgehend absehen. Sich leicht verändernde Studienfachwünsche spiegeln die Orientierung am Arbeitsmarkt wieder, nach wie vor mit Unterschieden nach dem Geschlecht sowie zwischen alten und neuen Bundesländern. Auffallend ist, dass sich die Gründe der Entscheidung für ein Studium bzw. Studienfach vor allem bei den weiblichen Gymnasiasten der alten Bundesländer deutlich verändert haben. Insgesamt ist damit eine weitere Angleichung der Positionen zum Studium zwischen ost- und westdeutschen, zwischen weiblichen und männlichen Gymnasiasten/innen zu erkennen. Die Einführung hochschuleigener Auswahlverfahren polarisiert die Meinungen in Abhängigkeit von den Schulleistungen und der Intensität der Studierwilligkeit.
(aus Pressemitteilung des HoF, im Internet: http://www.hof.uni-halle.de/index,id,76.html#261)
Download: http://www.hof.uni-halle.de/cms/download.php?id=89 
Studien des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie FIBS Berlin
Dieter Dohmen: "Der Studentenberg": Prognose und Realität, Berlin 2009. FiBS Forum Nr. 45
Nach Berechnungen des FiBS wird einerseits die Gesamtzahl der Studierenden auf höchstens 2,03 Millionen und damit nur noch geringfügig ansteigen, andererseits zeigt sich ein Trend hin zu ostdeutschen Hochschulen, deren Studienanfängerzahlen überproportional zulegen.
Aktuelle Analysen und Vorausberechnungen des Berliner Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) geben weitere Hinweise auf die Studierendenentwicklung in Deutschland.
1. [mehr]
Nach Berechnungen des FiBS wird einerseits die Gesamtzahl der Studierenden auf höchstens 2,03 Millionen und damit nur noch geringfügig ansteigen, andererseits zeigt sich ein Trend hin zu ostdeutschen Hochschulen, deren Studienanfängerzahlen überproportional zulegen.
Aktuelle Analysen und Vorausberechnungen des Berliner Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) geben weitere Hinweise auf die Studierendenentwicklung in Deutschland.
1. Die Zahl der Studierenden wird nur noch leicht von derzeit 2,01 auf höchstens 2,03 Millionen ansteigen. Ein darüber hinausgehender Anstieg wäre nur dann möglich, wenn sich die Übergangsquote bundesweit von aktuell knapp 80 Prozent auf 85 Prozent erhöhen würde. »Dies erscheint jedoch nach den Entwicklungen der vergangenen Jahre und Hinweisen auf eine leicht sinkende Studierneigung eher unwahrscheinlich,« erklärt Dr. Dieter Dohmen, der Direktor des FiBS. »Auch müsste dazu der Hochschulpakt auf 480.000 Studienanfängerplätze für den Zeitraum 2011 bis 2015 erhöht werden. Dies wären 200.000 zusätzliche Plätze im Vergleich zu den Vereinbarungen beim Bildungsgipfel.«
2. Im vergangenen Studienjahr 2008 ist die Studienanfängerzahl in den meisten ostdeutschen Ländern gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weisen historische Höchststände mit einer Übergangsquote von über 80 Prozent bezogen auf die eigenen Studienberechtigtenzahlen aus. Damit wird Ostdeutschland im Schnitt auf ein Niveau gehoben, das dem durchschnittlichen westdeutschen Niveau vergleichbar ist. Ursächlich hierfür dürften neben doppelten Abiturjahrgängen 2007 in Sachsen-Anhalt und 2008 in Mecklenburg-Vorpommern auch geringere Westwanderungen ostdeutscher Studienberechtigter sowie verstärkte Ostwanderungen westdeutscher Studienanfänger sein. Eine Analyse der Wanderungsbewegungen der letzten Jahre weist zudem darauf hin, dass auch die Einführung von Studiengebühren das Wanderungsverhalten von Studienanfängern beeinflusst hat. So ist die Zuwanderung in den meisten Ländern, die Studiengebühren eingeführt haben, nach 2005 im Vergleich zur Zeit vor der Einführung gesunken. Umgekehrt hat die Zuwanderung in den Ländern zugenommen, die keine Gebühren erheben.
Zwar ist die Übergangsquote im vergangenen Jahr auch in den meisten westdeutschen Ländern gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen, allerdings liegt sie dort mit derzeit 75 Prozent um rund fünf Prozentpunkte unter dem ostdeutschen Referenzwert. Nordrhein-Westfalen hat mit deutlichem Abstand die niedrigste Übergangsquote an die Hochschulen und liegt bei unter 60 Prozent trotz einer deutlichen Steigerung bei den absoluten Anfängerzahlen.
Ostdeutschland wird seine hohe Anfängerquote in den nächsten Jahren nur dann halten können, wenn es weiterhin zu hohen und eher noch zu steigenden Zuwanderungen aus den westdeutschen Ländern kommt. Sollte es gelingen, dass mehr Studienanfänger ihr Studium an einer ostdeutschen Hochschule aufnehmen, dann könnte dies den Ausbaubedarf an den westdeutschen Hochschulen verringern. Es ist allerdings auch zu erwarten, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise die Zahl der Ausbildungsplätze auch für Abiturienten verringern wird, sodass sich die Zahl der Studienbewerber erhöhen dürfte. In den vergangenen Jahren hat rund ein Drittel aller Studienberechtigten, dies sind fast 150.000, eine Berufsausbildung aufgenommen. (Text aus Pressemeldung übernommen, siehe http://www.fibs.eu/de/sites/presse/_wgHtml/presse_090303.htm).
Download: http://www.fibs.eu/de/sites/_wgData/Forum_045.pdf 
Dieter Dohmen, Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FIBS) Berlin, 2007: Zwischenruf: Ein Studentental, kein Studentenberg, in: Spiegel Online vom 01.02.2007
Die Studentenzahl wird in den nächsten Jahren rasant von zwei auf 2,7 Millionen Studenten steigen, orakeln die Kultusminister. Wirklich? Bildungsforscher Dieter Dohmen kommt zu einem ganz anderen Schluss: Bald wird es deutlich weniger Studenten als heute geben (Text übernommen).
Download: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,463318,00.html 
|