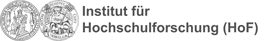PROMOVIERENDENTAGE zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte
Methoden, Inhalte und Techniken im Umgang mit Streitgeschichte
6. Promovierendentage 2010
Die 6. Promovierendentage 2010 widmeten sich der „Popularisierung“
fachwissenschaftlicher Erkenntnisse. In einem dreitägigen Workshop
bearbeiteten die Teilnehmenden unter Anleitung des Historikers und
Autors Christian von Ditfurth (selbst)kritisch eigene Textprodukte.
Veröffentlicht sind die Ergebnisse dieser Arbeit in der Rubrik "Promotionsprojekte".
Die inhaltliche Klammer der Veranstaltung bildeten, neben mehreren
begleitenden Vorträgen, zwei öffentliche Veranstaltungen zu
kontrafaktischer Geschichtsschreibung: Im Eröffnungsvortrag am 22. Juli
sprach Alexander Demandt (Altenstadt) zu „Chancen des Marxismus in
Deutschland seit 1848“; die 6. Promovierendentage endeten mit einer
Lesung Christian von Ditfurths (Ahrensbök) aus seinem Roman „Das
Luxemburg-Komplott“ am 25. Juli.
Programmübersicht (39KB)
Programm & Call for Papers (41 KB)
Organisation: Henning Schulze, Peer Pasternack
Bericht von:
Daniel Hechler
Institut für Hochschulforschung (HoF) Wittenberg an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
E-Mail: daniel.hechler[at]hof.uni-halle.de
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3244
6. Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte – Methoden, Inhalte und Techniken im Umgang mit ‚Streitgeschichte’
Veranstalter: Institut für Hochschulforschung (HoF) Wittenberg an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Datum, Ort: 22.-25.7.2010, Lutherstadt Wittenberg
Die Aufgabe eines Historikers besteht – so das berühmte Diktum Rankes – darin, zu „zeigen, wie es eigentlich gewesen“ ist. Mag dieser objektivistische Anspruch inzwischen auch stark relativiert worden sein, so überrascht es dennoch, eine Tagung von Nachwuchswissenschaftlern mit einem Vortrag zur kontrafaktischen Geschichtsschreibung zu eröffnen. Doch der von ALEXANDER DEMANDT (Altenstadt) bestrittene Auftakt der „6. Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte“ in Wittenberg vermittelte am Beispiel des Marxismus in Deutschland seit 1848 eindrücklich die Kerngedanken der kontafaktischen Historiographie: Indem diese kontrolliert über einen alternativen Verlauf der Geschichte spekuliert, schützt sie zum einen vor der teleologischen Versuchung, welche im Rückblick auf die Vergangenheit stets nur das Zwangsläufige erkennt und dabei die Handlungsspielräume und Zufälligkeiten ausblendet. Zum anderen macht die kontrafaktische Geschichte sichtbar, dass jeder Historiker implizit auf Annahmen über alternative Geschichtsverläufe angewiesen ist, ruht doch jede Wertung von Ereignissen oder Personen als bestimmend für die weiteren Geschehnisse auf der Vermutung, dass ohne ihr Erscheinen ein anderer Gang der Geschichte denkbar wäre.
Gleichwohl: Nicht die Kontingenz des Vergangenen bildete den zentralen Bezugspunkt dieser vom Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur veranstalteten Tagung. Gerade die Lektüre von Dissertationen erneuert regelmäßig die Erfahrung, dass Lesen auch Leiden bedeuten kann. Aber nicht nur, um Doktorvätern und -müttern qualvolle Stunden zu ersparen, auch die Frage danach, wie fachfremde Leser für die Ergebnisse der oft jahrelangen Forschungsarbeit interessiert werden könnten, inspirierte die Idee eines Schreibworkshops. Daher waren die Promovierenden bereits vor der Veranstaltung aufgefordert, entweder ihr Dissertationsvorhaben in einem simulierten Klappentext des dereinst fertigen Buches vorzustellen oder aber in einem fiktiven Beitrag den Lesern der historischen Publikumszeitschrift „Damals“ näher zu bringen.
Der Leiter des Schreibworkshops CHRISTIAN VON DITFURTH (Ahrensbök), selbst Historiker und Autor, nahm sich dieser Texte an und identifizierte mit sicherem Gespür typische Fehler wie unnötige Füllwörter, störende Parenthesen oder klischeehafte Formulierungen. Die Präsentation solcher Beispiele zum Workshopauftakt am Freitag illustrierte nicht nur die systematische Darstellung stilistischer Fehlleistungen und besserer Ausdrucksmöglichkeiten. Vielmehr zeigte sie nachdrücklich allen Teilnehmern, dass überall Optimierungsbedarf besteht, konnte doch jeder der Teilnehmer/innen unter den Beispielsätzen wenigstens einen als eigenen identifizieren. Derart sensibilisiert fanden sich ausgeloste Stellvertreterpaare – die bereits am Vortag zur Begrüßung das Dissertationsprojekt ihres Partners in großer Runde vorgestellt hatten – zur gemeinsamen Arbeit an den eigenen Texten zusammen.
Die von Christian von Ditfurth am nächsten Tag exemplarisch präsentierten sechs überarbeiteten Texte zeigten, dass das systematische Wissen um stilistische Fehlerquellen deutlich verbesserte Ergebnisse zeitigt, und inspirierten eine letzte Überarbeitungsrunde. Am Ende des Workshops wurden die Texte online gestellt (Promotionsprojekte). So erlebten die Teilnehmer/innen neben der Befriedigung, die mit der Fertigstellung eines gelungenen Textes einhergeht, auch einen Anflug jenes Gefühls, das sich mit der Publikation des eigenen Textes verbindet.
Doch gutes oder – wie Christian von Ditfurth es bescheidener formulierte – weniger schlechtes Schreiben ist kein Selbstzweck, sondern zielt nicht zuletzt auf die Verbreiterung des möglichen Adressatenkreises wissenschaftlicher Arbeiten. Diese Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit beleuchteten aus je spezifischer Perspektive die drei Vorträge, die den Schreibworkshop begleiteten.
IRMGARD ZÜNDORF (Berlin) stellte den deutschlandweit ersten Master-Studiengang für Public History der Freien Universität Berlin und des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam vor. Public History entstand in den 70er Jahren in den USA als Reaktion auf ein steigendes öffentliches Geschichtsinteresse, das die forschungsorientierte universitäre Historiographie nur unzureichend bediente. Public History fokussiert daher auf die Entwicklung neuer Formen öffentlicher Geschichtsvermittlung. Geschult an den Methoden der Medien- und Kommunikationswissenschaften bearbeitet sie zumeist zeitgeschichtliche Themen mit kultur- und alltagsgeschichtlichen Ansätzen. Hatte die Public History in den USA ihren Höhepunkt bereits in den 80er Jahren, so entstand der Master-Studiengang an der Freien Universität Berlin erst vor zwei Jahren. In einem festen Klassenverband organisiert und nach festem Stundenplan erwerben hier jährlich zwanzig Studierende zum einen theoretisches und methodisches Wissen zu Geschichtswahrnehmungen, Erinnerungskulturen und Deutungskonkurrenzen. Parallel dazu findet eine praxisnahe Einübung verschiedener medialer, musealer und anderer öffentlichkeitsbezogener Präsentationsformen von Geschichte statt. Bildet auch die Geschichtswissenschaft den Rahmen des Studiengangs – alle Studierende verfügen mindestens über ein abgeschlossenes Bachelor-Studium der Geschichte –, so erfordert die Brückenstellung der Public History zwischen Geschichtswissenschaft und öffentlicher Vermittlung eine gelungene Austarierung und Begrenzung der Studieninhalte. Geklärt werden muss daher, inwieweit historische Inhalte oder die Vermittlung technischer Fähigkeiten, wie das Programmieren einer Homepage oder die Handhabung einer Kamera, Bestandteil des Studiums sein sollen.
Ebenfalls im Spannungsfeld von Öffentlichkeit und Wissenschaft ist das Forschungsprojekt „Herstellung und Darstellung von Wissen unter Medialisierungsbedingungen“ von MARTINA FRANZEN und SIMONE RÖDDER (Bielefeld) angesiedelt. Die wesentlichen Bezugspunkte der Wissenschaft sind Wahrheit und aufgrund wissenschaftlicher Leistungen zuerkannte Reputation. Reputation (oder wenigstens Prominenz) kann allerdings auch über die gesteigerte Medienpräsenz von Forschungsthemen oder Wissenschaftlern entstehen. Freilich orientieren sich Medien in der Auswahl berichtenswerter Sachverhalte nur bedingt an wissenschaftlichen Kriterien. Medienresonanz finden primär überraschende Forschungsergebnisse, die sich knapp und verständlich darstellen lassen und an das vorhandene Publikumswissen anknüpfen können. Vor diesem Hintergrund sucht das Forschungsvorhaben, mögliche Rückwirkungen der Medienlogik auf die Wissenschaft unter anderem am Beispiel der Zeitgeschichte zu identifizieren.
Doch nicht nur Voraussetzung jeder Medienresonanz, sondern auch Abschluss jedes Promotionsverfahrens ist die Publikation der Dissertation. Nach Ende des Schreibworkshops informierte GERALD DIESENER (Leipzig) vom Leipziger Universitätsverlag daher ausführlich über den Weg vom fertigen Text zum Buch. Geduldig und humorig dämpfte er Erwartungen, bereits mit der Dissertation zum honorarscheffelnden Sachbuchautor zu avancieren, riet dazu, sich grundsätzlich mehrere Verlagsangebote einzuholen und die kalkulierten Druckkostenzuschüsse einerseits, Verlagsleistungen andererseits zu vergleichen und klärte über die heutigen Üblichkeiten beim Lektorat auf.
Den Abschluss der Tagung bildete am Sonntagmorgen die öffentliche Lesung Christian von Ditfurths aus seinem alternativhistorischen Roman „Das Luxemburg-Komplott“. Damit schlug er einen doppelten Bogen zum bisherigen Tagungsverlauf: Beinahe als nachgeschobener Kompetenzbeweis des Schreibworkshopleiters illustrierte er in Selbstanwendung die Möglichkeit, historische Inhalte an ein breites Publikum zu vermitteln, und rief zugleich die kritischen Möglichkeiten der kontrafaktischen Geschichtsschreibung ins Gedächtnis.
Tagungsübersicht
Öffentlicher Vortrag: „Was wäre geschehen, wenn... Chancen des Marxismus in Deutschland seit 1848.“ Prof. Dr. Alexander Demandt, Altenstadt
Workshop I: Schreibworkshop mit Christian von Ditfurth, Ahrensbök mit Schreibtraining + Arbeit an den Texten
Präsentation: Der Master-Studiengang Public History der Freien Universität Berlin und des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam. Dr. Irmgard Zündorf, Berlin
Präsentation: Forschungsprojekt „Herstellung und Darstellung von Wissen unter Medialisie-rungsbedingungen“. Dr. Martina Franzen/Dr. Simone Rödder, Bielefeld
Workshop II: Schreibtraining, Arbeit an den Texten
Vortrag: „Vom Dissertationstext zum Buch“ Dr. Gerald Diesener, Leipziger Universitätsverlag
Sonstiges: Führung durch das Haus der Geschichte Wittenberg
Öffentliche Lesung: „Das Luxemburg-Komplott“ von und mit Christian von Ditfurth im Festsaals des Rathauses Wittenberg
Programmübersicht (39KB)
Programm & Call for Papers (41 KB)
Organisation: Henning Schulze, Peer Pasternack
Bericht von:
Daniel Hechler
Institut für Hochschulforschung (HoF) Wittenberg an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
E-Mail: daniel.hechler[at]hof.uni-halle.de
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3244
6. Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte – Methoden, Inhalte und Techniken im Umgang mit ‚Streitgeschichte’
Veranstalter: Institut für Hochschulforschung (HoF) Wittenberg an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Datum, Ort: 22.-25.7.2010, Lutherstadt Wittenberg
Die Aufgabe eines Historikers besteht – so das berühmte Diktum Rankes – darin, zu „zeigen, wie es eigentlich gewesen“ ist. Mag dieser objektivistische Anspruch inzwischen auch stark relativiert worden sein, so überrascht es dennoch, eine Tagung von Nachwuchswissenschaftlern mit einem Vortrag zur kontrafaktischen Geschichtsschreibung zu eröffnen. Doch der von ALEXANDER DEMANDT (Altenstadt) bestrittene Auftakt der „6. Promovierendentage zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte“ in Wittenberg vermittelte am Beispiel des Marxismus in Deutschland seit 1848 eindrücklich die Kerngedanken der kontafaktischen Historiographie: Indem diese kontrolliert über einen alternativen Verlauf der Geschichte spekuliert, schützt sie zum einen vor der teleologischen Versuchung, welche im Rückblick auf die Vergangenheit stets nur das Zwangsläufige erkennt und dabei die Handlungsspielräume und Zufälligkeiten ausblendet. Zum anderen macht die kontrafaktische Geschichte sichtbar, dass jeder Historiker implizit auf Annahmen über alternative Geschichtsverläufe angewiesen ist, ruht doch jede Wertung von Ereignissen oder Personen als bestimmend für die weiteren Geschehnisse auf der Vermutung, dass ohne ihr Erscheinen ein anderer Gang der Geschichte denkbar wäre.
Gleichwohl: Nicht die Kontingenz des Vergangenen bildete den zentralen Bezugspunkt dieser vom Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur veranstalteten Tagung. Gerade die Lektüre von Dissertationen erneuert regelmäßig die Erfahrung, dass Lesen auch Leiden bedeuten kann. Aber nicht nur, um Doktorvätern und -müttern qualvolle Stunden zu ersparen, auch die Frage danach, wie fachfremde Leser für die Ergebnisse der oft jahrelangen Forschungsarbeit interessiert werden könnten, inspirierte die Idee eines Schreibworkshops. Daher waren die Promovierenden bereits vor der Veranstaltung aufgefordert, entweder ihr Dissertationsvorhaben in einem simulierten Klappentext des dereinst fertigen Buches vorzustellen oder aber in einem fiktiven Beitrag den Lesern der historischen Publikumszeitschrift „Damals“ näher zu bringen.
Der Leiter des Schreibworkshops CHRISTIAN VON DITFURTH (Ahrensbök), selbst Historiker und Autor, nahm sich dieser Texte an und identifizierte mit sicherem Gespür typische Fehler wie unnötige Füllwörter, störende Parenthesen oder klischeehafte Formulierungen. Die Präsentation solcher Beispiele zum Workshopauftakt am Freitag illustrierte nicht nur die systematische Darstellung stilistischer Fehlleistungen und besserer Ausdrucksmöglichkeiten. Vielmehr zeigte sie nachdrücklich allen Teilnehmern, dass überall Optimierungsbedarf besteht, konnte doch jeder der Teilnehmer/innen unter den Beispielsätzen wenigstens einen als eigenen identifizieren. Derart sensibilisiert fanden sich ausgeloste Stellvertreterpaare – die bereits am Vortag zur Begrüßung das Dissertationsprojekt ihres Partners in großer Runde vorgestellt hatten – zur gemeinsamen Arbeit an den eigenen Texten zusammen.
Die von Christian von Ditfurth am nächsten Tag exemplarisch präsentierten sechs überarbeiteten Texte zeigten, dass das systematische Wissen um stilistische Fehlerquellen deutlich verbesserte Ergebnisse zeitigt, und inspirierten eine letzte Überarbeitungsrunde. Am Ende des Workshops wurden die Texte online gestellt (Promotionsprojekte). So erlebten die Teilnehmer/innen neben der Befriedigung, die mit der Fertigstellung eines gelungenen Textes einhergeht, auch einen Anflug jenes Gefühls, das sich mit der Publikation des eigenen Textes verbindet.
Doch gutes oder – wie Christian von Ditfurth es bescheidener formulierte – weniger schlechtes Schreiben ist kein Selbstzweck, sondern zielt nicht zuletzt auf die Verbreiterung des möglichen Adressatenkreises wissenschaftlicher Arbeiten. Diese Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit beleuchteten aus je spezifischer Perspektive die drei Vorträge, die den Schreibworkshop begleiteten.
IRMGARD ZÜNDORF (Berlin) stellte den deutschlandweit ersten Master-Studiengang für Public History der Freien Universität Berlin und des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam vor. Public History entstand in den 70er Jahren in den USA als Reaktion auf ein steigendes öffentliches Geschichtsinteresse, das die forschungsorientierte universitäre Historiographie nur unzureichend bediente. Public History fokussiert daher auf die Entwicklung neuer Formen öffentlicher Geschichtsvermittlung. Geschult an den Methoden der Medien- und Kommunikationswissenschaften bearbeitet sie zumeist zeitgeschichtliche Themen mit kultur- und alltagsgeschichtlichen Ansätzen. Hatte die Public History in den USA ihren Höhepunkt bereits in den 80er Jahren, so entstand der Master-Studiengang an der Freien Universität Berlin erst vor zwei Jahren. In einem festen Klassenverband organisiert und nach festem Stundenplan erwerben hier jährlich zwanzig Studierende zum einen theoretisches und methodisches Wissen zu Geschichtswahrnehmungen, Erinnerungskulturen und Deutungskonkurrenzen. Parallel dazu findet eine praxisnahe Einübung verschiedener medialer, musealer und anderer öffentlichkeitsbezogener Präsentationsformen von Geschichte statt. Bildet auch die Geschichtswissenschaft den Rahmen des Studiengangs – alle Studierende verfügen mindestens über ein abgeschlossenes Bachelor-Studium der Geschichte –, so erfordert die Brückenstellung der Public History zwischen Geschichtswissenschaft und öffentlicher Vermittlung eine gelungene Austarierung und Begrenzung der Studieninhalte. Geklärt werden muss daher, inwieweit historische Inhalte oder die Vermittlung technischer Fähigkeiten, wie das Programmieren einer Homepage oder die Handhabung einer Kamera, Bestandteil des Studiums sein sollen.
Ebenfalls im Spannungsfeld von Öffentlichkeit und Wissenschaft ist das Forschungsprojekt „Herstellung und Darstellung von Wissen unter Medialisierungsbedingungen“ von MARTINA FRANZEN und SIMONE RÖDDER (Bielefeld) angesiedelt. Die wesentlichen Bezugspunkte der Wissenschaft sind Wahrheit und aufgrund wissenschaftlicher Leistungen zuerkannte Reputation. Reputation (oder wenigstens Prominenz) kann allerdings auch über die gesteigerte Medienpräsenz von Forschungsthemen oder Wissenschaftlern entstehen. Freilich orientieren sich Medien in der Auswahl berichtenswerter Sachverhalte nur bedingt an wissenschaftlichen Kriterien. Medienresonanz finden primär überraschende Forschungsergebnisse, die sich knapp und verständlich darstellen lassen und an das vorhandene Publikumswissen anknüpfen können. Vor diesem Hintergrund sucht das Forschungsvorhaben, mögliche Rückwirkungen der Medienlogik auf die Wissenschaft unter anderem am Beispiel der Zeitgeschichte zu identifizieren.
Doch nicht nur Voraussetzung jeder Medienresonanz, sondern auch Abschluss jedes Promotionsverfahrens ist die Publikation der Dissertation. Nach Ende des Schreibworkshops informierte GERALD DIESENER (Leipzig) vom Leipziger Universitätsverlag daher ausführlich über den Weg vom fertigen Text zum Buch. Geduldig und humorig dämpfte er Erwartungen, bereits mit der Dissertation zum honorarscheffelnden Sachbuchautor zu avancieren, riet dazu, sich grundsätzlich mehrere Verlagsangebote einzuholen und die kalkulierten Druckkostenzuschüsse einerseits, Verlagsleistungen andererseits zu vergleichen und klärte über die heutigen Üblichkeiten beim Lektorat auf.
Den Abschluss der Tagung bildete am Sonntagmorgen die öffentliche Lesung Christian von Ditfurths aus seinem alternativhistorischen Roman „Das Luxemburg-Komplott“. Damit schlug er einen doppelten Bogen zum bisherigen Tagungsverlauf: Beinahe als nachgeschobener Kompetenzbeweis des Schreibworkshopleiters illustrierte er in Selbstanwendung die Möglichkeit, historische Inhalte an ein breites Publikum zu vermitteln, und rief zugleich die kritischen Möglichkeiten der kontrafaktischen Geschichtsschreibung ins Gedächtnis.
Tagungsübersicht
Öffentlicher Vortrag: „Was wäre geschehen, wenn... Chancen des Marxismus in Deutschland seit 1848.“ Prof. Dr. Alexander Demandt, Altenstadt
Workshop I: Schreibworkshop mit Christian von Ditfurth, Ahrensbök mit Schreibtraining + Arbeit an den Texten
Präsentation: Der Master-Studiengang Public History der Freien Universität Berlin und des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam. Dr. Irmgard Zündorf, Berlin
Präsentation: Forschungsprojekt „Herstellung und Darstellung von Wissen unter Medialisie-rungsbedingungen“. Dr. Martina Franzen/Dr. Simone Rödder, Bielefeld
Workshop II: Schreibtraining, Arbeit an den Texten
Vortrag: „Vom Dissertationstext zum Buch“ Dr. Gerald Diesener, Leipziger Universitätsverlag
Sonstiges: Führung durch das Haus der Geschichte Wittenberg
Öffentliche Lesung: „Das Luxemburg-Komplott“ von und mit Christian von Ditfurth im Festsaals des Rathauses Wittenberg