
Newsletter Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF)
20.12.2019
Falls der Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, bitte hier klicken.
Inhalt
Projektergebnisse und Publikationen
Third Mission und Wissenschaftsmanagement
Einer trage des anderen Administrationslast: Organisatorische Anforderungen an Hochschulen
„Wie auf einem Basar“: Gender Pay Gap an Hochschulen in Niedersachsen
Das andere Bauhaus-Erbe: Leben in den Plattenbausiedlungen heute
Wissenschaft in Mittelstädten: Gewinne für die Stadtentwicklung und Alternativen
Wissenschaftskommunikation als Ausweg aus der Legitimationskrise? – Die Rolle der Mesoebene
Nach den Exzellenzentscheidungen: Input- und Output-Daten der ostdeutschen Universitäten
MINT und Med in der DDR: Drei Jahrzehnte zeitgeschichtliche Erforschung und Aufarbeitung
1. Projektergebnisse und Publikationen
Third Mission und Wissenschaftsmanagement

Hochschulen können sich kaum mehr einer strategischen Entwicklung der Third Mission entziehen, denn es werden von ihnen verstärkt zusätzliche Beiträge zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung erwartet. Hierfür sind sie allerdings – so die These – auch auf das Wissenschaftsmanagement angewiesen, dessen konzeptionelle Zuarbeiten und operative Tätigkeiten sie benötigen.
Justus Henke: Third Mission als Organisationsherausforderung. Neuausrichtung der Machtstrukturen in der Hochschule durch Professionalisierungstendenzen im Wissenschaftsmanagement, BWV – Berliner Wissenschafts‐Verlag, Berlin 2019, 294 S.
Inhaltsverzeichnis und zentrale Ergebnisse
Kontakt: Justus Henke
Einer trage des anderen Administrationslast: Organisatorische Anforderungen an Hochschulen
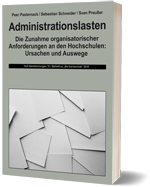
Die Wahrnehmungen des Hochschulpersonals sind durch zweierlei geprägt: Entstaatlichungen habe neue Bürokratieanforderungen gebracht, und die Verwaltung der strukturierten Bologna-Studiengänge ginge gleichfalls mit neuen Belastungen einher. Eine Handreichung widmet sich den Ursachen dessen und Optionen für Problembearbeitungen.
Peer Pasternack/Sebastian Schneider/Sven Preußer: Administrationslasten. Die Zunahme organisatorischer Anforderungen an den Hochschulen: Ursachen und Auswege (HoF-Handreichungen 10), Institut für Hochschulforschung (HoF), Halle-Wittenberg 2019, 146 S.; online verfügbar
Kontakt: Peer Pasternack; Sebastian Schneider; Sven Preußer
„Wie auf einem Basar“: Gender Pay Gap an Hochschulen in Niedersachsen

Anhand der von staatlichen Hochschulen in Niedersachsen für 2016 zur Verfügung gestellten Angaben zu den Leistungsbezügen in den Besoldungsgruppen W2 und W3 wurde ermittelt, dass Professorinnen im landesweiten Durchschnitt finanziell schlechter gestellt sind als Professoren. Mit einem Gender Pay Gap von 27 Prozent sind Universitäten (ohne Medizin) besonders betroffen. Der höchste prozentuale Unterschied wurden hier in den Sprach- und Kulturwissenschaften registriert. Die Fragen nach den Gründen für den Gender Pay Gap und den Möglichkeiten, ihm entgegenzuwirken, standen im Mittelpunkt der Interviews mit Gleichstellungsbeauftragten, Hochschulleitungen sowie Professorinnen und Professoren.
Anke Burkhardt/Florian Harrlandt/Jens-Heinrich Schäfer: „Wie auf einem Basar“. Berufungsverhandlungen und Gender Pay Gap bei den Leistungsbezügen an Hochschulen in Niedersachsen (HoF-Arbeitsbericht 110), unt. Mitarb. v. Judit Anacker, Aaron Philipp, Sven Preußer, Philipp Rediger, Institut für Hochschulforschung (HoF), Halle-Wittenberg 2019, 142 S.; online verfügbar
Kontakt: Anke Burkhardt; Jens-Heinrich Schäfer
Das andere Bauhaus-Erbe: Leben in den Plattenbausiedlungen heute
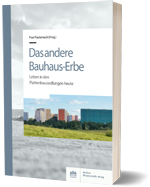
Im Osten Deutschlands lebt heute jede/jeder Fünfte in einer Plattenbausiedlung. Dort handelt es sich um prägende Elemente der Stadtlandschaften, in den westlichen Bundesländern um deren gelegentliche Ergänzungen. Funktional und sozial waren die ostdeutschen Siedlungen in den letzten drei Jahrzehnten den westdeutschen sehr ähnlich geworden: Schrumpfung, Segregation, Bildungsarmut und ein entsprechendes Image prägen die Situation. Einst hingegen, in der DDR, galten sie als Orte städtebaulicher Modernität und privilegierten Wohnens. 100 Jahre nach der Bauhausgründung und 30 Jahre nach dem Versinken des Sozialismus widmen sich die Autor.innen dieses Buches der Frage, wie zutreffend die Außenwahrnehmung der ostdeutschen Plattenbausiedlungen ist und welche Umsteuerungen angeraten sind.
Peer Pasternack (Hg.): Das andere Bauhaus-Erbe. Leben in den Plattenbausiedlungen heute, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2019, 211 S.
Inhaltsverzeichnis und zentrale Ergebnisse
Kontakt: Peer Pasternack
2. Neue Projekte
Wissenschaft in Mittelstädten: Gewinne für die Stadtentwicklung und Alternativen
Die unlängst veröffentlichte HoF-Studie „Wissenschaft und Stadtentwicklung in mittelgroßen Städten“ hat nicht nur Antworten geliefert, sondern auch offene Fragen identifiziert. Wesentlichen davon wird nun in einem Anschlussprojekt nachgegangen. Dabei liegt der Fokus auf Mittelstädten, also solchen mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern, die nicht nur in der stadtbezogenen Hochschul- und Wissenschaftsforschung, sondern auch in der Stadt- und Regionalforschung stark unterbelichtet sind. Das Projekt unternimmt einen Vergleich von Mittelstädten mit und ohne Hochschulen bzw. sonstigen Wissenschaftseinrichtungen. Dabei geht es zunächst um die Frage, welche Entwicklungspotenziale Städte dieser Größenordnung tatsächlich dadurch gewinnen, dass sie (eine) wissenschaftliche Einrichtung(en) beherbergen, indem sie verglichen werden mit Städten, die über diese Standorteigenschaft nicht verfügen. Anschließend wird gefragt, ob und wie Mittelstädte ohne Wissenschaftsinstitutionen diesen Standortnachteil ggf. durch andere Aktivitäten auszugleichen vermögen.
Kontakt: Steffen Zierold
Wissenschaftskommunikation als Ausweg aus der Legitimationskrise? – Die Rolle der Mesoebene
Aktuelle Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in die Wissenschaft bei den Bürger.innen abnimmt. Dabei passt sich die Wissenschaft schon länger an die Erwartungen der Öffentlichkeit an, und wissenschaftsbezogene Konflikte werden medial verarbeitet. Zugleich werden Rufe nach bürgerlicher Partizipation, Transparenz und Responsivität lauter. Das Habilitationsprojekt erforscht in diesem Rahmen die Rolle der Wissenschaftskommunikation der Mesoebene, d.h. von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Dabei werden sowohl Transparenz von Wissenschaft, die Beteiligung der Zivilgesellschaft als auch kommunikative Reaktionsmuster in Fällen wissenschaftsbezogenen Fehlverhaltens in den Blick genommen. Ziel ist ein theoretisch und empirisch gesättigtes Modell einer Krisen(präventions)kommunikation, das deren Legitimätswirkungen erklären kann.
Kontakt: Justus Henke
Nach den Exzellenzentscheidungen: Input- und Output-Daten der ostdeutschen Universitäten
Die Universitäten in den ostdeutschen Flächenländern haben bei der Exzellenzstrategie 2019 unterdurchschnittlich abgeschnitten. Das setzt tendenziell die regionsspezifischen Ergebnisse der Exzellenzinitiative 2006/2007 und 2012 fort. Vor diesem Hintergrund hat sich eine Initiativgruppe der Hochschulratsvorsitzenden ostdeutscher Universitäten gebildet. In deren Auftrag und unterstützt vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft stellt HoF eine konsolidierte Datengrundlage her, mit der sich Inputs und Outputs der ostdeutschen Universitäten ins Verhältnis setzen lassen. Insbesondere müssen diese Daten, da sie nicht ‚sprechen‘, ins Verhältnis zu Referenzgrößen (wie Landesgröße, Hochschulsystemgröße oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Länder) gesetzt werden. Aus den Referenzgrößen lassen sich dann Erwartungswerte ableiten: Aufgrund der Anteile am BIP, an der Einwohnerzahl usw. aller Flächenländer, die ein Land bzw. Ostdeutschland insgesamt hat, kann erwartet werden, dass die prozentualen Anteile bei hochschulbezogenen Inputs und Outputs in etwa den sozioökonomischen Referenzdaten entsprechen. Das Erreichen, Unter- oder Überschreiten der Erwartungswerte bietet dann realistische Referenzen für die Bewertung der hochschulspezifischen Input- und Output-Daten, die sich so zum ‚sprechen‘ bringen lassen.
Kontakt: Sascha Blasczyk; Peer Pasternack
MINT und Med in der DDR: Drei Jahrzehnte zeitgeschichtliche Erforschung und Aufarbeitung
Seit mittlerweile 30 Jahren werden auch die Naturwissenschaften der DDR analysiert, dokumentiert und erinnert. Das geschieht in unterschiedlichen Kontexten: Fakultäten, Forschungsinstitute, Kliniken und Fachgesellschaften arbeiten ihre DDR-Geschichte auf, Zeitzeugen schreiben Autobiografien, Promovierende erarbeiten Dissertationsschriften, Zeithistoriker.innen betreiben Forschungs- und Dokumentationsprojekte, und wo es auf die DDR-Geschichte bezogene Skandalisierungen gab, legten Untersuchungskommissionen Berichte vor. Entsprechend vielfältig sind die Zugangsweisen und Textsorten. Der so entstandene immense Textkorpus wird aufgearbeitet, ausgewertet und bibliografisch dokumentiert.
Kontakt: Peer Pasternack
3. Veranstaltung: Nachlese
Plattenbausiedlungen in Sachsen-Anhalt: Transferworkshop der Expertenplattform Demographischer Wandel
Für die Expertenplattform hatte HoF (Peer Pasternack und Steffen Zierold) den diesjährigen Transferworkshop organisiert. Waren im vergangenen Jahr die ländlichen Regionen das Thema, so ging es am 1.7.2019 um die Problemfälle im urbanen Bereich: die Plattenbausiedlungen. Gastgeber für die 51 Teilnehmer.innen aus Quartiersmanagement, Kommunalverwaltungen, Wohnungswirtschaft und Wissenschaft war das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
Peer Pasternack: Das andere Bauhaus-Erbe. Leben in den Plattenbausiedlungen Sachsen-Anhalts heute. Transferworkshop der Expertenplattform Demographischer Wandel in Sachsen-Anhalt, EPF, Halle (Saale) 2019, 28 S.; online verfügbar
4. Artikel online
Sollte ein Link nicht funktionieren, finden Sie alle Meldungen auch auf: www.hof.uni-halle.de
Sie erhalten diesen Newsletter, da Ihre Emailadresse für den
Newsletterversand
des Instituts für Hochschulforschung an der
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg angemeldet wurde. Der Newsletter wird etwa
vierteljährlich
verschickt; andere Absender haben keinen Zugriff auf die eingetragenen
Adressen
und diese werden nicht an Dritte weitergegeben.
Sie können hier mit einer kurzen Nachricht Ihre Adresse ändern oder
sich abmelden.
Institut
für Hochschulforschung (HoF)
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Collegienstraße 62
06886 Lutherstadt Wittenberg
Sekretariat: 03491/466-254
institut@hof.uni-halle.de
http://www.idw-online.de/pages/de/pressreleases370